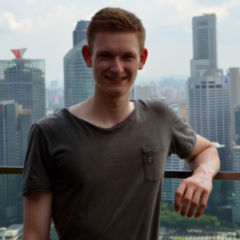Idiopathisches Parkinson-Syndrom
Synonyme: Morbus Parkinson, Parkinson-Krankheit
Englisch: idiopathic Parkinson's disease, IPD
Definition
Das idiopathische Parkinson-Syndrom, kurz IPS, ist eine der häufigsten neurodegenerativen Erkrankungen. Seine Kardinalsymptome sind Hypokinese bzw. Bradykinese, Rigor, Tremor und posturale Instabilität.
Nomenklatur
In der aktuellen Leitlinie von 2023 wird empfohlen, den Begriff "idiopathisches Parkinson-Syndrom" durch "Parkinson-Krankheit" zu ersetzen. Die Begründung dafür ist, dass einem bedeutenden Anteil der Krankheitsfälle eine genetische Ursache zugrunde liegt und sie somit nicht als idiopathisch bezeichnet werden können. Im klinischen Alltag ist die ursprüngliche Bezeichnung jedoch weiterhin geläufig.
Epidemiologie
Das idiopathische Parkinson-Syndrom ist mit einer Prävalenz von 150 auf 100.000 Einwohner in Deutschland eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen. Das mittlere Erkrankungsalter liegt zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr. Betroffen sind v.a. Männer. Beginnt die Erkrankung vor dem 40. Lebensjahr, spricht man von einer "früh beginnenden" Parkinson-Erkrankung ("Early Onset Parkinson's Disease", EOPD), bei Beginn vor dem 21. Lebensjahr von einer "juvenilen" Parkinson-Erkrankung. In einem solchen Fall ist ein genetischer Hintergrund wahrscheinlich.
Ätiologie
Die Ursache ist aktuell (2026) noch ungeklärt. Vermutet wird eine multifaktorielle Genese:
- polygenetische Prädisposition: u.a. gibt es bisher 16 Genloci (PARK 1– 21) für seltene, autosomal vererbte Formen.
- Neurotoxine: nach Exposition gegenüber Pestiziden oder Lösungsmittel ist das Erkrankunsrisiko erhöht.
- Schwere Schädel-Hirn-Traumata in der Anamnese: erhöhtes Erkrankungsrisiko
Eine mögliche Kausalkette liefert die sogenannte Braak-Hypothese. Demnach beginnt die Erkrankung im Darm (Frühsymptom: Obstipation) oder im Bulbus olfactorius (Frühsymptom: Geruchsstörung) mit Akkumulation von α-Synuclein im enterischen Nervensystem und retrogradem Transport ins ZNS. Mögliche Umweltfaktoren und der genetische Hintergrund bestimmen dabei das Erkrankungsalter und den Verlauf.
Pathologie
Beim IPS kommt es zum Verlust und zur Degeneration von dopaminergen Neuronen, vor allem in den ventrolateralen Anteilen der Substantia nigra pars compacta.
Darüber hinaus sind die Neurone des Locus coeruleus (noradrenerg), der Raphe-Kerne (serotoninerg), des Nucleus basalis Meynert (cholinerg), des dorsalen Vaguskern und des Bulbus olfactorius betroffen. Im späteren Verlauf kommt es ebenfalls zu einer Beteiligung der Hirnrinde und der peripheren sympathischen Ganglien.
In den degenerierenden Neuronen finden sich sogenannte Lewy-Körper. Dabei handelt es sich um hyaline eosinophile Einschlusskörperchen. Darüber hinaus zeigt sich ein extrazelluläres Pigment, sowie eine Mikroglia- und Astroglia-Aktivierung.
Weiterhin kann man pathohistologisch α-Synuklein-Aggregate in Hautnerven (v.a. zervikal) identifizieren. Diese Ablagerungen führen möglicherweise zu einer Fehlfunktion der betroffenen Synapsen. Tierexperimentelle Studien lassen sogar vermuten, dass sich abweichend gefaltetes α-Synuklein - analog zur Creutzfeldt-Jakob-Krankheit - wie ein Prion verhält.
Klassifikation
Nach dem klinischen Verlauf lassen sich verschiedene Formen des IPS differenzieren:
- Äquivalenz-Typ: Die typischen Symptome Akinese, Rigor und Tremor sind annähernd gleich stark ausgeprägt.
- Akinetisch-rigider Typ: Die Akinese und der Rigor dominieren, ein Tremor fehlt komplett oder ist lediglich minimal ausgeprägt.
- Tremordominanz-Typ: Der Tremor dominiert, Akinese und Rigor sind lediglich minimal ausgeprägt.
- Monosymptomatischer Ruhetremor: Seltene Variante, bei welcher der Ruhetremor klar dominiert.
Klinik
Die motorischen Symptome prägen das klinische Bild des idiopathischen Parkinson-Syndroms. Die typischen Leitsymptome sind Hypokinese (verminderte Bewegungsamplitude) bzw. Akinese (hochgradige Bewegungsarmut, Bewegungsstarre) und Bradykinese (Bewegungsverlangsamung). Sie treten in Kombination mit weiteren Kardinalsymptomen wie Rigor, Ruhe- und/oder Haltetremor sowie einer posturaler Instabilität (Haltungsinstabilität mit Verlust der Haltungsreflexe) auf.
Die Symptomatik präsentiert sich in der Regel zunächst halbseitig und armbetont, im weiteren Verlauf nimmt sie zu und greift auf die Gegenseite über.
Akinese
Die Akinese fällt klinisch u.a. durch eine Hypomimie, eine Dysarthrie mit Mikrophonie sowie eine Palilalie auf. Bei hochgradiger Störung der Mimik kommt es zu einer Amimie mit Maskengesicht. An den Extremitäten präsentiert sich die Akinese z.B. durch ein kleinschrittiges Gangbild, ein vermindertes Mitschwingen der Arme beim Gehen, eine reduzierte Finger- bzw. Fußgeschicklichkeit und eine Störung von alternierenden Bewegungen. Die Patienten zeigen zudem ein verkleinertes Schriftbild (Mikrographie). Darüber hinaus berichten sie über Schwierigkeiten beim Aufstehen bzw. Umdrehen im Bett.
Rigor
Unter Rigor versteht man einen erhöhten Ruhetonus der Muskulatur. Er manifestiert sich durch ein subjektiv empfundenes Steifigkeitsgefühl. Bei der passiven Bewegung der Extremitäten lässt sich diese Steifigkeit durch einen zähen Bewegungswiderstand objektivieren. Dabei kommt es zum sogenannten "Zahnradphänomen". Der Rigor tritt unabhängig von der Geschwindigkeit der Gelenksbewegung auf. Ggf. kann er zu Rücken- bzw. Schulter-Arm-Schmerzen führen.
Tremor
Typisch für das idiopathische Parkinson-Syndrom sind Ruhetremor und/oder Haltetremor. Die Frequenz des Tremors beträgt dabei in der Regel etwa 4-8 Hz. Häufig zeigt er sich als sogenannter "Pillendreher-Tremor" an den Händen. Beim Beginn von Willkürbewegungen nimmt seine Amplitude ab. Der Tremor wird durch geistige Beschäftigung oder Emotionen intensiviert.
Posturale Instabilität
Die posturale Instabilität zeigt sich durch eine Fallneigung, die nicht primär durch visuelle, vestibuläre, zerebelläre oder propriozeptive Störungen erklärbar ist. Normalerweise wird das Gleichgewicht beim Stehen und Gehen durch Reflexe reguliert, die weitgehend autonom ablaufen. Beim IPS kommt es zu einer Verminderung dieser Reflexe, so dass die Betroffenen nicht in der Lage sind, sich selbst "aufzufangen", wenn sie aus dem Gleichgewicht gebracht werden.
Weitere Symptome
Weitere mögliche Symptome sind:
- Sensorische Symptome: wie Dysästhesien, Schmerzen, Hyposmie
- Vegetative Symptome: wie Störungen von Blutdruck- und/oder Temperaturregulation, Blasenfunktionsstörungen, Störung der Darmfunktion, sexuelle Dysfunktion, vermehrte Talgsekretion (Salbengesicht), Pseudohypersalivation bedingt durch Schluckstörungen
- Psychische Symptome: v.a. Depressionen
- Psychotische Symptome: visuelle, akustische, olfaktorische oder taktile Halluzinationen, Wahnvorstellungen, Impulskontrollstörungen, Apathie
- Schlafstörungen: REM-Schlaf-Verhaltensstörung (RBD), Restless-Legs-Syndrom
- Kognitive Symptome: Konzentrationsstörungen, frontale Störungen, leichte kognitive Störung (PD-MCI), in fortgeschrittenen Stadien Demenz (PDD, s.u.)
- Fatigue
- Schmerzen
Staging
Die Einteilung in Schweregrade erfolgt mittels der Skala nach Hoehn und Yahr bzw. der Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) oder der MDS-UPDRS.
Komplikationen
Im weiteren Verlauf der Erkrankungen können u.a. folgende Komplikationen auftreten:
- Freezing (Einfrieren): abruptes Unterbrechen von Bewegungsabläufen
- Freezing of gait (FOG): Eine Form des Freezings beim Gehen mit kleinen, sich beschleunigenden Schritten oder Trippeln auf der Stelle bzw. einer Starthemmung beim Loslaufen
- Dyskinesien: meist Hyperkinesien (Überbewegungen)
- Dystonien (Haltungs- und Bewegungsstörungen): z.B. zunehmende Vorbeugung des Rumpfes (Kamptokormie) oder seitliche Neigung des Rumpfes (Pisa-Syndrom)
- Akinetische Krise
- Sturzneigung und Stürze
Unter der Medikation kann es ferner zu Wirkungsfluktuationen bzw. Wirkungsschwankungen kommen.
Bei etwa 30 % der Patienten mit IPS kommt es im langjährigen Verlauf der Erkrankung zur Entstehung einer Parkinson-Demenz (PDD).[1]
Diagnostik
Die Diagnose eines Parkinson-Syndroms wird klinisch gestellt. Zur Differenzierung des IPS gegenüber anderen Formen des Parkinson-Syndroms werden verschiedene Zusatzuntersuchungen hinzugezogen. Zu den standardmäßig durchzuführenden Untersuchungen gehören:
- Komplette neurologische Untersuchung mit besonderer Aufmerksamkeit auf:
- Anamnestische Angaben zu Beginn und Dauer der Beschwerden, Seitenbetonung, autonomen Funktionen, Familienanamnese
- Akinese (Bradydiadochokinese), Rigor (Froment-Manöver, Kopffalltest, Armpendeltest), Tremor, posturale Instabilität (Pull-Test, Push-and-Release-Test)
- Okulomotorikstörungen: Sakkadengeschwindigkeit, vertikale Blickparese, vestibulo-okulärer Reflex (VOR), Fixationssuppression des VOR
- Frontale Zeichen wie Primitivreflexe (Glabella-Reflex) oder motorische Perseverationen
- Zerebelläre Zeichen
- Pyramidenbahnzeichen
- Symptome einer kognitiven Leistungseinbuße
- Symptome einer Apraxie
- Symptome von Verhaltens- oder psychischen Störungen
- Labor: unauffällig, Ausschluss eines Morbus Wilson
- Bildgebende Verfahren:
- Transkranielle Sonographie: Bereits in präklinischen Stadien kann sich eine Hyperechogenität der Substantia nigra zeigen.
- MRT bzw. CT: unauffällig. Abgrenzung zu atypischen Parkinson-Syndromen mit typischen MRT-Zeichen
- Nuklearmedizinische Untersuchungen (PET, SPECT)
- Neurologische Funktionstests:
- Zusatzdiagnostik
- Riechtest mittels "sniffin sticks"
- Tremoranalyse
- Polysomnographie
- Sphinkter-EMG
- Schellong-Test
- Kipptischuntersuchung
Diagnosekriterien
Die Diagnose eines IPS stützt sich auf folgende Kriterien:
- Parkinson-Syndrom mit Akinese/Bradykinese und mindestens einem der folgenden Symptome: Muskulärer Rigor, Ruhetremor und posturale Instabilität.
- Vorhandensein unterstützender Kriterien:
- Einseitiger Beginn und persistierende Asymmetrie im Krankheitsverlauf
- Klassischer Ruhetremor
- Eindeutig positives Ansprechen (> 30 % UPDRS motorisch) auf L-Dopa
- Anhaltende L-Dopa-Ansprechbarkeit über mehr als 5 Jahre
- Auftreten von L-Dopa-induzierten choreatischen Dyskinesien
- Langsame klinische Progression mit Krankheitsverlauf über mehr als 10 Jahre
- Fehlen von Ausschlusskriterien, z.B.:
- Hinweise für ein symptomatisches Parkinson-Syndrom
- Hinweise auf ein atypisches Parkinson-Syndrom
Differentialdiagnosen
Neben den sekundären und atypischen Parkinson-Syndromen sind folgende Erkrankungen wichtige Differenzialdiagnosen des IPS:
- Pseudo-Parkinson-Syndrome
- Normaldruckhydrozephalus (NDH, NPH)
- Vaskuläres Parkinson-Syndrom (subkortikale vaskuläre Enzephalopathie, SAE)
- chronisch traumatische Enzephalopathie (CTE, "Boxerenzephalopathie")
- Essentieller Tremor
- Depression
- Fahr-Krankheit
Therapie
Eine kausale Therapie ist zur Zeit (2026) nicht möglich. Sämtliche Behandlungsansätze sind rein symptomatisch. Je nach Alter, Erkrankungsdauer, Begleiterkrankungen und sozialer Situation kommen folgende therapeutische Möglichkeiten zum Einsatz:
Medikamentöse Therapie
Die medikamentöse Therapie eines IPS sollte rechtzeitig und patientenindividuell erfolgen.
Therapie der 1. Wahl
- Alter unter 70 Jahre: aufgrund von möglichen Spätkomplikationen wie Wirkungsfluktuationen oder Dyskinesien wird eine L-Dopa-Monotherapie zunächst vermieden. Bevorzugte Arzneistoffe sind:
- Dopaminagonisten vom Non-Ergot-Typ, z.B. Ropinirol, Pramipexol, Rotigotin
- MAO-B-Hemmer, z.B. Selegilin, Rasagilin
- Alter über 70 Jahre:
- L-Dopa (in Kombination mit einem Decarboxylasehemmer wie Benserazid oder Carbidopa)
Therapie der 2. Wahl
Therapeutika der 2. Wahl werden lediglich in speziellen klinischen Situationen angewendet. Dazu zählen:
- Amantadin: zur Therapie der akinetischen Krise.
- COMT-Hemmer, z.B. Entacapon, Opicapon oder Tolcapon (nur in Kombination mit L-Dopa, es sind Kombinationspräparate auf dem Markt erhältlich)
- Anticholinergika, z.B. Biperiden
- Dopaminagonisten vom Ergot-Typ, z.B. Bromocriptin oder Pergolid. Cave: Diese Wirkstoffe können Herzklappenfibrosen verursachen.
Therapie bei stärkerer Symptomatik
Bei stärkerer Symptomatik bzw. bei beginnenden Fluktuationen kann eine Kombination verschiedener Präparate eingesetzt werden, z.B. L-Dopa + Non-Ergot-Dopaminagonisten oder MAO-B-Hemmer oder COMT-Hemmer.
Bei motorischen Fluktuationen kann eine Apomorphin-Pumpentherapie zur Reduktion von Off-Phasen, zur Reduktion von Dyskinesien und zur Verlängerung der On-Zeit eingesetzt werden. Kann eine orale Therapie mit L-Dopa motorische Fluktuationen nicht suffizient verhindern, kommt Levodopa-Carbidopa-Intestinal-Gel (LCIG, Duodpa) als Pumpentherapie über eine PEG-Sonde infrage. Noch nicht in die Leitlinie aufgenommen (Stand 2025) ist die subkutane Pumpentherapie mit Foslevodopa-Foscarbidopa-Infusionslösung.
Auch bei Patienten mit Dysphagie ist ggf. eine Therapieumstellung sinnvoll, wenn die Schluckstörungen die orale Therapie zu stark erschweren.
Zur Kupierung von Off-Symptomen kann inhalatives L-Dopa eingesetzt werden, jedoch nur in Kombination mit einem oralen L-Dopa-Präparat, da es keinen Decarboxylasehemmer enthält.
Tiefe Hirnstimulation
Sollte eine medikamentöse Therapie nicht zum gewünschten Erfolg führen und ist das IPS stark ausgeprägt (starke Wirkfluktuationen, ausgeprägte Off-Phasen, starke Dyskinesien), besteht die Möglichkeit der tiefen Hirnstimulation (DBS). Ein Hirnschrittmacher kann dabei je nach dominierender Symptomatik an unterschiedlichen Lokalisationen implantiert werden.
Unterstützende Therapie
Als nicht-medikamentöse unterstützende Maßnahmen kommen u.a. begleitend in Betracht:
Verlauf und Prognose
Die Krankheit zeigt einen progredienten und stadienhaften Verlauf, der mit verschiedenen motorischen und kognitiven Beeinträchtigungen verbunden ist. Bei rechtzeitiger Erkennung und guter Therapie ist die Lebenserwartung jedoch nicht deutlich verkürzt.
Quiz
Bildquelle
- Bildquelle für Flexikon-Quiz: © hermaion / pexels
Literatur
Quelle
- ↑ Koschel, J. Ist eine Parkinson-Demenz bei langjährig Erkrankten seltener als bisher gedacht? DNP 21, 20 (2020).