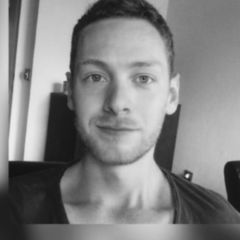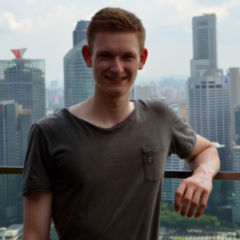Spondylitis ankylosans
Synonyme: Ankylosierende Spondylitis, Morbus Bechterew, Bechterew-Strümpell-Marie-Krankheit, Spondylarthritis ankylopoetica
Englisch: ankylosing spondylitis
Definition
Die Spondylitis ankylosans ist eine chronische Entzündung der kleinen Wirbelgelenke aus dem rheumatischen Formenkreis. Sie gehört zur Gruppe der seronegativen Spondylarthritiden. Die bevorzugte Manifestation der Systemerkrankung liegt im Bereich der kaudalen Wirbelsäule und der Iliosakralgelenke (ISG).
siehe auch: Spondylitis
Epidemiologie
Das männliche Geschlecht ist 2,5- bis 5-mal häufiger betroffen. Aufgrund eines etwas abweichenden Verlaufs ist bei Frauen jedoch von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Frauen weisen seltener eine Beteiligung des Achsenskeletts und der Hüfte, aber häufiger einen Befall von peripheren Gelenken, eine Osteitis pubis und isolierte Beteiligung der Halswirbelsäule auf.
Der Erkrankungsgipfel liegt zwischen dem 15. und 30. Lebensjahr.
Ätiologie
Eine eindeutige Ätiologie konnte noch (2024) nicht nachgewiesen werden. Es handelt sich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Autoimmunerkrankung bzw. um eine Autoinflammation. Die Spondylitis ankylosans ist in der europäischen Bevölkerung in über 90 % der Fälle mit HLA-B27 assoziiert. Es wird daher von einer hohen genetischen Prädisposition ausgegangen.
Symptomatik
Die Erkrankung hat einen charakteristischen, schubweisen Verlauf. In der Frühphase steht die Schmerzsymptomatik im Vordergrund. Die Patienten klagen insbesondere über nächtliche Rückenschmerzen. Während des chronischen Verlaufes verringert sich die Beweglichkeit, meist unter Ausbildung einer verstärkten thorakalen Kyphose und einer verminderten lumbalen Lordose. Aufgrund der fehlenden Seitenmobilität der Wirbelsäule kann eine begleitende Skoliose zu einer ausgeprägten Abweichung der Wirbelsäule aus der Senkrechten führen, da die Kompensationsmöglichkeiten durch die Einsteifung fehlen. In späten Stadien kann die Atmung durch verringerte Thoraxexpansion beeinträchtigt sein. Weiterhin besteht ein erhöhtes Risiko für eine Wirbelkörperquerfraktur (sog. "Chalk Stick Fracture") mit Verletzung des Rückenmarks nach bereits leichten Traumata.
Neben den typischen Kreuzschmerzen leiden viele Patienten an einer asymmetrischen oligoartikulären peripheren Arthritis und Enthesiopathien z.B. im Bereich der Achillessehne (Achillodynie).
Im Verlauf zeigen sich auch häufig extraartikuläre Symptome. Bei rund einem Viertel der Patienten kommt es zu einer akuten Uveitis anterior. Auch eine kardiovaskuläre Beteiligung mit Störungen des Reizleitungssystems (AV-Block) sowie eine Aortitis mit Klappenbeteiligung sind beschrieben. Weitere mögliche Manifestationen sind:
- Beteiligung des Kolons oder der Harnröhre (Urethritis)
- Beteiligung von Lunge und Pleura: meist apikal betonte interstitielle Lungenerkrankung[1][2][3]
Zudem kann es wie bei anderen chronischen Entzündungen zu einer sekundären Amyloidose kommen, ggf. mit Nephritis.
Diagnostik
Klinik
Neben der typischen Körperhaltung kann die Atemexkursion des Thorax, die mit einem Maßband quantifiziert wird, weitere Aufschlüsse liefern: Bei Bechterew-Patienten beträgt der Unterschied zwischen Inspiration und Expiration meist weniger als 2 cm. Die Beteiligung der Iliosakralgelenke lässt sich durch das Mennell-Zeichen prüfen. Zur Beurteilung der Wirbelsäulenbeweglichkeit können auch das Ott-Zeichen bzw. das Schober-Zeichen herangezogen werden. Klinisch sehr einfach zu prüfen und bei der Spondylitis ankylosans häufig pathologisch ist auch der Hinterkopf-Wand-Abstand (HWA).
Bildgebung
Die Spondylitis ankylosans betrifft folgende Lokalisationen:
- Iliosakralgelenk: untere 1/2 bis 1/3 der Synovia
- Wirbelsäule:
- Vorderkanten der Wirbelkörper
- anteriore Fasern des Annulus fibrosus
- evtl. Ligamentum longitudinale anterius
- Extremitätengelenke: v.a. proximale große Gelenke (Hüftgelenk, Schultergelenk)
- Sehnen: Achsenskelett und proximale Extremitäten. Enthesiopathien kommen vor allem am Ligamentum interspinale sowie bei den Sehnen im Bereich des Beckens vor.
In den ersten 20 Jahren sind vor allem die Lendenwirbelsäule, später auch Halswirbelsäule betroffen. Früher wurde von einem kontinuierlich aufsteigenden Prozess von kaudal nach kranial ausgegangen. Es handelt sich aber um einen diffusen, diskontinuierlichen Befall.
siehe auch: Axiale Spondylarthritis (Radiologie)
Röntgen
In frühen Stadien ist das Röntgenbild noch unauffällig. Entscheidender Hinweis auf eine Spondylitis ankylosans sind dünne vertikale Syndesmophyten und eine begleitende bilaterale Sakroiliitis. Ferner kommt es zu einer diffusen Osteopenie des Achsenskeletts. Im Endstadium versteift sich die gesamte Wirbelsäule bambusstabförmig und es kommt zur Kastenwirbelbildung. Die kyphotische Fehlstellung führt zum Totalrundrücken.
Im Einzelnen zeigen sich folgende Befunde:
Sakroiliitis
Die Sakroiliitis tritt meist bilateral symmetrisch auf (ca. 86 % d.F.), zu Beginn kann sie asymmetrisch vorliegen. Anfangs sieht man eine Gelenkspalterweiterung, im weiteren Verlauf tritt dann eine Gelenkspaltverschmälerung auf, die schließlich zu einer Fusion (Ankylose) führt. Subchondral sind Erosionen und Sklerose erkennbar.
Wirbelsäule
- Shiny Corner Sign im Bereich der anterioren Wirbelkörperkanten (Romanus-Läsionen)
- Im Verlauf Bildung von rechteckigen Wirbelkörpern (Kastenwirbel, "Squaring"): am besten an der Wirbelkörpervorderfläche erkennbar
- dünne vertikale Syndesmophyten, ausgehend vom Anulus fibrosus
- langstreckige Fusion der Wirbelkörper und Facettengelenke: Bambuswirbelsäule. Dagger Sign. Vollständige Fusion in 28 % d.F. nach 30 Erkrankungsjahren und in 43 % bei über 40 Jahren.
- ggf. atlantoaxiale Subluxation
Aufgrund der Fusion und Osteoporose besteht ein erhöhtes Risiko für eine Wirbelsäulenquerfraktur. Sie ist meist nicht disloziert und im Röntgenbild nur schwer erkennbar. Am häufigsten betrifft die den Bereich des zervikothorakalen oder thorakolumbalen Übergangs.
Weiteres Achsenskelett
Es kommt zu Erosionen und evtl. Fusionen im Bereich von Sternoklavikulargelenk, Kostochondralgelenk und/oder Kostovertebralgelenk.
Periphere Arthritis
Betroffen sind vor allem die großen Gelenke, wobei die Hüftgelenke häufiger als die Schultergelenke befallen sind. Meist liegt ein asymmetrisches Muster vor. Neben einer uniformen Gelenkspaltverschmälerung sieht man Gelenkerosionen oder produktive Veränderungen (Osteophyten).
- Hüfte: Protrusio acetabuli, Osteophyten am Übergang von Femurkopf zu Femurhals
- Schulter: große, beilförmige Erosionen im anterolateralen Bereich des Humeruskopfes (Hatchet Sign). Knochenmarködem des Akromions am Ursprung des Musculus deltoideus
Die distalen Gelenke sind selten bzw. nur bei inadäquater Therapie befallen. Im Bereich der Hände bestehen dann meist asymmetrische, kleine Erosionen und eine marginale Periostitis.
Computertomographie
Die Computertomographie (CT) wird insbesondere nach einem Trauma durchgeführt, um eine Chalk Stick Fracture nachzuweisen. Weiterhin werden chronische Veränderungen wie Erosionen, subchondrale Sklerose und Ankylose im CT besser dargestellt.
Magnetresonanztomographie
In der Magnetresonanztomographie (MRT) können bereits Frühzeichen der Spondylitis ankylosans nachgewiesen werden:
- T1w:
- Romanus-Läsionen: hypointenses, dreieckiges Ödem in den (meist anterioren) Wirbelkörperkanten
- hypointenses Knochenmarködem im ISG-Gelenk
- chronische Romanus- und ISG-Läsionen entwickeln ein hyperintenses, fettiges Knochenmark
- große Syndesmophyten können ein hyperintenses Knochenmark aufweisen
- Flüssigkeitssensitive Sequenzen (T2-FS, PD-FS, STIR)
- hyperintense Enthesiopathie (Frühzeichen): v.a. Ligamenta interspinalia, Spina iliaca anterior superior, Trochanter major und minor, Schambeinast
- Romanus-Läsionen: hyperintense anteriore Wirbelkörperkanten. Meist vor Syndesmophytenbildung. Chronische Läsionen werden durch Fett ersetzt.
- Andersson-Läsionen: wie Romanus-Läsionen nur zentraler im Bereich des Wirbelkörper-Bandscheiben-Übergangs (aseptische Spondylodiszitis)
- hypointense Syndesmophyten: im MRT schwerer abgrenzbar als im Röntgenbild
- Wirbelkörperquerfraktur: ggf. mit Myelopathie
- ISG-Gelenk: hyperintense Synovialis (am besten auf schräg-koronaren STIR-Sequenzen)
- T1-FS mit Kontrastmittel: Enhancement von
- aktiven Romanus- und Anderson-Läsionen
- aktiver Enthesiopathie
- ISG-Synovitis
Pulmonale Manifestationen
Im Röntgen-Thorax finden sich meist bilaterale symmetrische Verdickungen der apikalen Pleura. Zusätzlich sieht man eine Fibrose der Oberfelder mit Retraktion der Lungenhili. Die Bildung von Zysten und Bullae in den Oberfeldern (fibrobullöse Manifestation) prädisponiert für eine Kolonisation mit Aspergillus. Dadurch entstehen Myzetome mit Hämoptysen.
In der CT können folgende Befunde auffallen:
- Erkrankung der Atemwege (80 %):
- Mosaikmuster und Air Trapping (40 %)
- Traktionsbronchiektasen
- Lungenemphysem (33 %): meist zentrilobulär, seltener paraseptal. Weiterhin Narbenemphysem.
- Interstitielle Lungenerkrankung (66 %):
- Parenchymbänder (33 %)
- subpleurale Noduli, intralobuläre Linien, subpleurale Linien, Honeycombing
- "Apikale Lungenerkrankung": Traktionsbronchiektasen, Volumenverlust, Dilatation der Trachea, bilaterale symmetrische Verdickung der apikalen Pleura (Pleurakuppenschwielen).
Differenzialdiagnosen
- Enteropathische Arthritis: zugrundeliegende chronisch-entzündliche Darmerkrankung. Identisches radiologisches Erscheinungsbild einer Sakroiliitis, Spondylitis und peripherer Arthritis.
- Psoriasisarthritis: meist bilaterale asymmetrische Sakroiliitis, asymmetrische paravertebrale Ossifikationen, normale Knochendichte, Hände am häufigsten betroffen.
- chronische reaktive Arthritis: meist bilaterale asymmetrische Sakroiliitis, asymmetrische paravertebrale Ossifikationen, normale Knochendichte, Füße am häufigsten betroffen.
- Arthrose des Achsenskeletts: Normale Knochendichte. Osteophyten sind weiter von der Bandscheibe entfernt und eher horizontal ausgerichtet. Degenerative Veränderungen der Wirbelkörperendplatten können im MRT ähnlich wie eine Romanus-Läsion erscheinen, weisen jedoch im Allgemeinen eine breitere Form auf. Assoziierte Bandscheibendegeneration und Facettenarthrose. Im Bereich des ISG Sklerose und marginale Osteophyten.
- DISH: fließende Verknöcherung des Ligamentum longitudinale anterius. Normalerweise keine Beteiligung der Facettengelenke. Keine echte Sakroiliitis, sondern Verknöcherung der nicht-synovialen oberen Anteile des ISG. Normale Knochendichte.
- femoroacetabuläres Impingement: "Bump" im lateralen Schenkelhals bei CAM-Impingement kann mit einem Osteophyt bei Spondylitis ankylosans verwechselt werden. Keine Sakroiliitis.
Die pulmonalen Manifestationen müssen radiologisch von folgenden Differenzialdiagnosen unterschieden werden:
- Tuberkulose: kann zu ähnlichen fibrokavitären Veränderungen der Oberlappen führen
- Sarkoidose: Oberlappen- und peribronchovaskulär-betonte Lungenveränderungen, meist mit kleinen perilymphatischen Noduli sowie symmetrischer hilärer und mediastinaler Lymphadenopathie.
- Silikose, Anthrakosilikose: Oberlappen-betonte zentrilobuläre und subpleurale Noduli mit deutlicher bihilärer und mediastinaler Lymphadenopathie (meist mit Eierschalenverkalkung).
- idiopathische pleuroparenchymale Fibroelastose: seltene chronische idiopathische interstitielle Pneumonie.
Therapie
Die Spondylitis ankylosans wird zu Beginn medikamentös mit nichtsteroidalen Antiphlogistika und Biologika (TNF-Hemmer) behandelt. TNF-Hemmer beeinflussen die Schmerzen, die Beweglichkeit und vermindern eine Versteifung.
Um die Mobilität möglichst lange zu erhalten, sind physiotherapeutische Behandlungsprogramme indiziert. Aufrichtungsosteotomien sind angezeigt, wenn eine Einsteifung in hochgradiger Fehlstellung vorliegt. Die konsequente Therapie hat eine geradlinigere Wirbelsäule zur Folge, die Gegenarbeit zur Kyphosenbildung bringt allerdings eine Schmerzverstärkung mit sich.
Quellen
- ↑ Marquette D et al. Chronic bronchiolitis in ankylosing spondylitis. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. 2013
- ↑ Kanathur N, Lee-Chiong T. [Pulmonary manifestations of ankylosing spondylitis]. Clin Chest Med. 2010
- ↑ El Maghraoui A et al. Lung findings on thoracic high-resolution computed tomography in patients with ankylosing spondylitis. Correlations with disease duration, clinical findings and pulmonary function testing. Clin Rheumatol. 2004