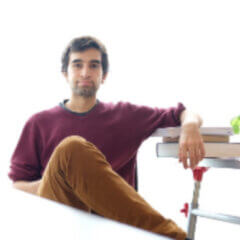Autismus
von altgriechisch: αὐτός ("autós") - selbst
Englisch: autism
Definition
Der Autismus bzw. die Autismus-Spektrum-Störung ist eine komplexe und vielgestaltige neurologische Entwicklungsstörung, deren genaue Ursache unbekannt ist. Sie wird als genetisch bedingte Veränderung der Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitung des Gehirns beschrieben, die sich bereits im frühen Kindesalter bemerkbar machen kann.
Hintergrund
Der grundlegende Unterschied zur neurotypischen Entwicklung ist eine mangelnde Fähigkeit, Wahrnehmungsreize zu filtern. Dies führt zu einer situativ und individuell verschieden stark ausgeprägten Reizüberflutung mit Überforderung. Dies löst reflexartige, individuell sehr unterschiedliche Schutz- und Abwehrreaktionen aus.
Nomenklatur
Basierend auf der Klassifikation nach DSM-5 und ICD-11 werden die einzelnen autistischen Unterformen nicht mehr als separate Diagnosen erfasst, sondern die Hauptdiagnose Autismus-Spektrum-Störung vergeben. Mit der Vergabe der einheitlichen Hauptdiagnose für alle autistischen Personen soll verdeutlicht werden, dass das autistische Spektrum fließend ist und zur Zeit (2023) keine klare Abgrenzung von Subtypen möglich ist.
Früher wurden die verschiedenen Unterformen auch unter dem Begriff der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen zusammengefasst.
Epidemiologie
Die Angaben zur Prävalenz von Autismus-Spektrum-Störungen schwanken in den USA zwischen 6 und 11 Fällen pro 1.000 Einwohner.[1] Aufgrund der schwierigen Abgrenzung der Diagnose bieten diese Zahlen allerdings bestenfalls einen Anhaltspunkt für die tatsächliche Häufigkeit. Weltweit sollen Schätzungen zufolge etwa 62,2 Millionen Menschen von einer Autismus-Spektrum-Störung betroffen sein.[2]
Ätiologie
Autismus ist wahrscheinlich eine polygen vererbte Störung, an der zwischen 6 und 10 Gene beteiligt sind.[3] Für eine Vererbung spricht die Tatsache, dass das Erkrankungsrisiko bei Geschwistern von Patienten 50- bis 100-mal höher als in der Durchschnittsbevölkerung ist. Bei eineiigen Zwillingen besteht eine Konkordanz von 60 % bis 95 %. Nicht nur Vollbild tritt unter Verwandten gehäuft auf, sondern auch einzelne Symptomkomplexe (z.B. ausgeprägte Kontaktstörungen, stereotype Verhaltensweisen, kognitive Einschränkungen).
Es gibt Hinweise darauf, dass eine gestörte Funktion der glutaminergen Neurotransmission an der Pathogenese des Autismus beteiligt ist.[4]
Ein gehäuftes Auftreten wurde bei Kindern beobachtet, deren Mütter während der Schwangerschaft mit Antikonvulsiva behandelt wurden. Das betrifft insbesondere Valproinsäure. Für Topiramat und Lamotrigin ist die Datenlage bisher (2024) unsicher.[5]
Symptomatik
Autismus zeigt sich vor allem in drei übergeordneten Lebensbereichen:
- Veränderte soziale Interaktion mit Problemen im sozialen Umgang und Austausch
- Veränderte verbale und nonverbale Kommunikation (u.a. Blickkontakt, Körpersprache)
- Eingeschränktes bzw. selektives Interessenspektrum mit Neigung zu Stereotypien
Aufgrund dieser Veränderungen werden Autisten häufig als "gestört" bzw. "sozial unfähig" stigmatisiert. Gerade bei gering ausgeprägten Autismusformen entspricht dies jedoch nicht der Realität und ist diskriminierend, da Autismus nur eine extreme Verstärkung eines Teils des menschlichen Verhaltensrepertoires darstellt.
Autismus ist im Wesentlichen unabhängig von der Intelligenzentwicklung, bei ausgeprägtem Autismus können jedoch auch eine Intelligenzminderung und weitere Einschränkungen auftreten. In diesen Fällen benötigen die Betroffenen meist eine lebenslange Unterstützung.
Alte Einteilung
Man geht heute (2024) davon aus, dass es einen fließenden Übergang zwischen den alten, im ICD-10 definierten Autismus-Subtypen sowie zwischen Autismus und Nicht-Autismus gibt. Eine Klassifikation im Sinne genau umschriebener Subtypen ist deshalb weitgehend obsolet. Dennoch werden im klinischen Alltag bzw. in der medizinischen Umgangssprache teilweise noch die alten Subtypen verwendet, die im Folgenden aufgeführt werden.
Frühkindlicher Autismus
Der frühkindliche Autismus zeichnet sich durch eine Manifestierung der Symptome vor dem 3. Lebensjahr aus. Er wird auch als Kanner-Autismus, Kanner-Syndrom oder infantiler Autismus bezeichnet. Er manifestiert sich früher als das Asperger-Syndrom und führt zu einer Verzögerung der Sprachentwicklung, die durch Echolalien, Neologismen und Iterationen gekennzeichnet ist. In etwa 30 % der Fälle ist den Betroffenen keine Lautsprache möglich. Die Intelligenz kann – im Gegensatz zum Asperger-Syndrom – vermindert sein. Der frühkindliche Autismus manifestiert sich meist ab dem 10. und 12. Lebensmonat. Er lässt sich nach dem Ausmaß der Einschränkungen in zwei weitere Subtypen unterteilen, den niedrigfunktionalen Autismus (LFA) und den hochfunktionalen Autismus (HFA).
Niedrigfunktionaler Autismus
Der niedrigfunktionale Autismus (LFA, low functioning autism) geht mit deutlicherer Ausprägung der oben genannten Symptomatik und einer Intelligenzminderung einher. Die klinische Einordnung ist jedoch nicht selten falsch, da bei einer ausgeprägten Verzögerung der Sprachentwicklung die Intelligenz fälschlicherweise zu niedrig eingeschätzt werden kann.
Hochfunktionaler Autismus
Einen frühkindlichen Autismus mit normaler oder hoher Intelligenz bezeichnet man als hochfunktionalen Autismus (HFA, high functioning autism). Er wird im Autismusspektrum zwischen Nichtautismus und LFA verortet. HFA-Autisten sind als Erwachsene häufig nicht von Asperger-Autisten zu unterscheiden, die autistischen Symptome sind aber ausgeprägter als beim Asperger-Syndrom. Auch bei stark eingeschränkter Sprachentwicklung kann ein HFA-Autismus vorliegen – die Betroffenen können sich dann schriftlich äußern.
Asperger-Syndrom
Das Asperger-Syndrom ist nach traditioneller Vorstellung eine in der Regel ab dem dritten Lebensjahr auftretende Form des Autismus ohne Sprachentwicklungsverzögerung und ohne Intelligenzminderung. Es ist nach dem österreichischen Mediziner Hans Asperger benannt. Das Asperger-Syndrom kann in Einzelfällen mit überdurchschnittlicher Intelligenz oder Inselbegabungen einhergehen. Leichtere Fälle des Asperger-Syndroms werden im Englischen auch als "Little Professor Syndrome", "Geek Syndrome" oder "Nerd Syndrome" bezeichnet.
Atypischer Autismus
Unter dem Begriff "atypischer Autismus" wurden früher alle Autismusformen zusammengefasst, deren Manifestationsalter oder Symptomatik sich vom "typischen" Autismus unterschieden. Autistische Kinder mit atypischem Erkrankungsalter weisen alle Symptome eines frühkindlichen Autismus auf, die sich bei ihnen aber erst nach dem 3. Lebensjahr manifestieren. Autistische Kinder mit atypischer Symptomatik legen nur einen Teil der autistischen Auffälligkeiten an den Tag und erfüllen die Diagnosekriterien des frühkindlichen Autismus nicht vollständig. Dabei können sich die Symptome sowohl vor als auch nach dem 3. Lebensjahr verfestigen.
Diagnose
Die Diagnose der Autismus-Spektrum-Störung ist eine klinische Diagnose, die sich insbesondere auf die (Fremd-)Anamnese, eine Beobachtung des Verhaltens, sowie verschiedene Fragebögen zur Erfassung autistischer Züge stützt.
Bei Verdacht auf eine Autismus-Spektrum-Störung erfolgt zunächst ein Screening, dem sich dann ggf. eine detaillierte Diagnostik anschließt.
Screening
Ein breites Screening auf das Vorliegen von Autismus-Spektrum-Störungen wird in Deutschland bisher (2023) nicht empfohlen. Es wird erst bei begründetem Verdacht durchgeführt. Der Verdacht kann z.B. durch Eltern, Pädagogen oder den Kinderarzt im Rahmen der U-Untersuchungen geäußert werden. Auch verschiedene genetische Befunde, ein niedriges Geburtsgewicht oder Virusinfektionen in der Schwangerschaft können z.B. einen Verdacht begründen.
Es existieren sehr viele verschiedene Fragebögen, deren Validität teilweise stark variiert. Aufgrund der unzureichenden Studienqualität wird in der Leitlinie kein Instrument uneingeschränkt empfohlen. Valide Testinstrumente sind z.B.:
- Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT): für Kinder ab dem 2. Lebensjahr, Spezifität sehr niedrig
- Fragebogen zur Sozialen Kommunikation (FSK): für Vorschul- und Grundschulkinder oder Erwachsene mit Intelligenzminderung, gehört zu den am besten untersuchten Fragebögen, erreicht je nach Patientenpopulation eine Sensitivität von bis zu 80 %)
- Marburger Beurteilungsskala zum Asperger-Syndrom (MBAS): Grundschul- bis Jugendalter zur Erkennung einer hoch-funktionalen Autismus-Spektrum-Störung (nach alter Klassifikation)
- Social Responsiveness Scale (SRS): Vorschul- bis Jugendalter, Sensitivität und Spezifität variieren je nach Cut-Off-Wert, gute Abgrenzung von ASS zu ADHS, sozialer Phobie und selektivem Mutismus
- Social Responsiveness Scale for Adults (SRS-A) und Autismus-Spektrum-Quotient (AQ): können im Erwachsenenalter eingesetzt werden, Spezifität niedrig
- Skala zur Erfassung von Autismus-Spektrum-Störungen bei Minderbegabten (SEAS-M): Bei Kindern und Erwachsenen mit Intelligenzminderung
Weitere Fragebögen, die zum Screening eingesetzt werden, sind der Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ) und der Ritvo Autism & Asperger Diagnostic Scale (RAADS-14).
Diagnostische Abklärung
Bei positivem Screening schließt sich eine detaillierte diagnostische Abklärung in einem spezialisierten Zentrum an. Folgende Aspekte werden dabei geprüft:
- Erfassung der Symptome nach ICD-11 bzw. DSM-5
- (Fremd-)Anamnese der aktuellen Symptomatik und Symptome im Vor- und Schulalter
- Beobachtung des Verhaltens
- Erhebung eines psychopathologischen Befunds
- Entwicklungsdiagnostik mit kognitiver Testung
- Erfassung der Sprachentwicklung bei Verdacht auf ein Defizit
- Erfassung des aktuellen Funktionsniveaus in Bezug auf Familie, Schule oder Beruf
- internistisch-neurologische Untersuchung
- ergänzende (Labor-)Untersuchungen
Im Rahmen des diagnostischen Prozesses werden teils standardisierte Diagnoseinstrumente eingesetzt. Dazu gehören z.B. das Autism Diagnostic Interview Revised (ADI-R), ein strukturiertes Interview mit den Eltern und der betroffenen Person, oder der Autism Diagnostic Observation Schedule Second Edition (ADOS-II).
Diagnosekriterien nach DSM-5
Das DSM-5 teilt die Diagnosekriterien der Autismus-Spektrum-Störung (ASS) in fünf Teilbereiche (A bis E) auf. Für die Diagnose einer Autismus-Spektrum-Störung müssen alle Kriterien des Bereichs A und drei von vier Kriterien im Bereich B erfüllt sein.
- A) Anhaltende Defizite der sozialen Kommunikation und Interaktion, die sich über mehrere Lebensbereiche erstrecken und sich durch folgende Merkmale manifestieren (aktuell oder in der Vergangenheit):
- Defizite der sozial-emotionalen Reziprozität (Gegenseitigkeit), z.B. ungewöhnliche soziale Annäherung, Fehlen einer normalen wechselseitigen Konversation, vermindertes Teilen von Interessen, Emotionen und Affekten
- Defizite des nonverbalen Kommunikationsverhaltens in der sozialen Interaktionen, z.B. fehlender oder reduzierter Blickkontakt bzw. fehlende oder reduzierte Körpersprache, Defizite im Verständnis und im Gebrauch von Gestik und Mimik bzw. vollständiges Fehlen von Mimik und nonverbaler Kommunikation.
- Defizite bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung von sozialen Beziehungen, z.B. Schwierigkeiten, das eigene Verhalten an den sozialen Kontext anzupassen oder Schwierigkeiten, sich in Rollenspielen auszutauschen oder Freundschaften zu schließen
- B) Restriktive, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten, die sich durch mindestens zwei der folgenden Merkmale manifestieren (aktuell oder anamnestisch):
- Stereotype oder repetitive Struktur der Sprache, der Motorik und des Objektgebrauchs, z.B. Echolalie, motorische Stereotypien, idiosynkratische Phrasen, repetitive Verwendung von Gegenständen
- Übermäßiges Einhalten von Routinen oder ritualisierten Sprach- und Handlungsabläufen mit rigiden Denkmustern und Disstress schon bei kleinen Veränderungen
- Enges, fixiertes Interessenspektrum. Die Interessen sind in ihrer Intensität oder ihrem Inhalt abnorm, z.B. starke Bindung an bestimmte Objekte oder Beschäftigung mit ungewöhnlichen Objekten
- Hyper- oder Hyporeaktivität auf sensorische Reize oder ungewöhnliches Interesse an Umweltreizen, z.B. scheinbare Gleichgültigkeit gegenüber Schmerzen, Hitze oder Kälte, ablehnende Reaktion auf spezifische Geräusche oder Texturen, exzessives Beriechen oder Berühren von Objekten
- C) Die Symptome müssen schon in früher Kindheit vorhanden sein, können sich aber auch erst dann manifestieren, wenn die sozialen Anforderungen die eingeschränkten Möglichkeiten des Betroffenen überschreiten. In späteren Lebensphasen können die Symptome auch durch erlernte Strategien überdeckt sein.
- D) Die Symptome führen zu einer relevanten Beeinträchtigung in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen bzw. zu einem klinisch bedeutsamen Leidensdruck.
- E) Die Symptome lassen sich nicht durch eine intellektuelle Beeinträchtigung oder eine allgemeine Entwicklungsverzögerung erklären. Intellektuelle Beeinträchtigungen und Autismus-Spektrum-Störungen kommen häufig zusammen vor. Um die Diagnosen Autismus-Spektrum-Störung und Intellektuelle Beeinträchtigung gemeinsam stellen zu können, sollte die soziale Kommunikationsfähigkeit unter dem erwarteten alterspezifischen Entwicklungsniveau liegen.
Bei den Kategorien A und B werden zusätzlich drei Schwergrade unterschieden:
- Schweregrad 1: Unterstützung erforderlich
- Schweregrad 2: Umfangreiche Unterstützung erforderlich
- Schweregrad 3: Sehr umfangreiche Unterstützung erforderlich
Differentialdiagnostik
Im Rahmen der Diagnostik muss als letzter Schritt eine intensive Abklärung etwaiger Differentialdiagnosen erfolgen. Zu den Differentialdiagnosen von Autismus-Spektrum-Störungen zählen u. a.:
- ADHS
- Aphasien anderer Ursache
- Anorexia nervosa
- Bindungsstörungen
- Borderline-Persönlichkeitsstörung
- Depression
- Eingeschränktes Hörvermögen (z.B. Schwerhörigkeit)
- Heller-Demenz
- Hospitalismus
- Intelligenzminderung
- Mutismus
- Persönlichkeitsstörungen
- Schizoide Persönlichkeitsstörung (SPS)
- Schizophrenie
- Soziale Phobie
- Sprachstörung
- Störung des Sozialverhaltens
- Tic-Störung
- Zwangsstörungen
- Genetische Defekte (u.a. Angelman-Syndrom, Fragiles-X-Syndrom, Rett-Syndrom, Urbach-Wiethe-Syndrom)
Therapie
Verhaltenstherapie
Die Verhaltenstherapie soll den Betroffenen dabei helfen, subjektiv störende, übermäßige Stereotypien abzubauen und andererseits fehlende kommunikative Fähigkeiten aufbauen. Erwünschtes Verhalten wird durchgängig und deutlich erkennbar belohnt. Verhaltenstherapien können entweder ganzheitlich oder auf einzelne Symptome gerichtet sein, sie werden individuell angepasst. Bei Autismus zeigt dieser klassische Therapieansatz nicht immer Erfolge, da Stereotypien und andere Auffälligkeiten meist Symptome sind, die bei einer Reizüberflutung entlastend wirken.
Applied Behavior Analysis
Die Applied Behavior Analysis (ABA) ist eine ganzheitlich ausgerichtete Therapieform, die auf die Frühförderung ausgerichtet ist. Zuerst wird festgestellt, welche Fähigkeiten und Funktionen das Kind bereits besitzt und welche nicht. Hierauf aufbauend werden spezielle Programme erstellt, die das Kind befähigen sollen, die fehlenden Funktionen zu erlernen. Das Verfahren der ABA basiert hauptsächlich auf den Methoden der operanten Konditionierung. Man motiviert die Betroffenen bei richtigem Verhalten, belohnt mit positiver Verstärkung und versucht zugleich das unerwünschte Verhalten durch Bestrafung "auszulöschen“. Als Belohnung werden primäre, positive Verstärker (z.B. Nahrungsmittel) und materielle Verstärker (z.B. Spielzeug) eingesetzt.
Die Wirksamkeit der ABA wird kontrovers diskutiert. Reviews der vorliegenden Studien kommen zu keinen klaren Aussagen und sehen teilweise nur eine geringe Evidenz für die beschriebenen Therapieeffekte. Die ABA steht darüber hinaus unter starker Kritik der Autismus-Community, da dieser Ansatz genauso wie die Verhaltenstherapie eine hohe Anpassungsleistung fordert und den Stresslevel der Betroffenen erhöhen kann.
Elterntraining
Das Elterntraining versucht, den Stress der Eltern zu reduzieren, der durch den Autismus ihres Kindes ausgelöst wird und sich im Gegenzug auf das Kind überträgt. Dies wird vor allem durch "Übersetzung" der anderen Denkweise erreicht. Es wurde nachgewiesen, dass eine Stressreduktion und ein besseres Verständnis zu deutlichen Verbesserungen im Verhalten autistischer Kinder führen, unabhängig davon, wie ausgeprägt die Symptome sind.
Soziales Kompetenztraining
Menschen mit einer geringgradig ausgeprägten Autismus-Spektrum-Störung, die sprachlich und kognitiv nicht beeinträchtigt sind, können gezielt fehlende soziale und kommunikative Fähigkeiten trainieren. Anhand von Rollenspielen werden für das Alltagsleben relevante Kommunikationsformen intensiv erklärt und trainiert.
Pharmakotherapie
Zur Zeit (2023) gibt es keine medikamentöse Kausaltherapie von Autismus-Spektrum-Störungen. Medikamente werden nur gegen Begleitsymptome bzw. Komorbiditäten wie Angst, Depressionen, Aggressivität oder Zwänge eingesetzt. Hier kommen u.a. Psychopharmaka wie Antidepressiva, Neuroleptika oder Antikonvulsiva (z.B. Pregabalin gegen generalisierte Angststörungen) zum Einsatz. Benzodiazepine werden ebenfalls gegeben, sind aber wegen des hohen Abhängigkeitspotentials nur zur Kurzzeittherapie in der Akutphase vertretbar.
Bei der Pharmakotherapie von Autismus-Spektrum-Störungen ist das subjektive Empfinden des Patienten unter der Medikation ein wichtiger Entscheidungsfaktor.
Andere Therapieformen
In der Ergotherapie kommen vielfältige Methoden wie handwerkliche, gestalterische, spielerische sowie alltagsbezogene Aktivitäten zum Einsatz, um grob- und feinmotorische Fähigkeiten zu fördern, etwa die Koordination, Kraftdosierung oder Handgeschicklichkeit. Darüber hinaus werden auch kognitive, soziale und emotionale Kompetenzen in den Blick genommen. Ziel der Ergotherapie ist es, die Teilhabe am Alltag zu verbessern, Selbstständigkeit zu fördern und Betätigungen zu ermöglichen, die bedeutungsvoll sind. Die Interventionen orientieren sich dabei stets an den individuellen Lebenszielen und Ressourcen der Betroffenen.
Die Physiotherapie konzentriert sich primär auf die Verbesserung motorischer Funktionen. Insbesondere bei Autismus-Spektrum-Störungen, bei denen häufig eine motorische Ungeschicklichkeit oder Muskeltonusstörungen auftreten, kann sie durch gezielte Bewegungs- und Koordinationsübungen hilfreich sein. Sie unterstützt unter anderem Gleichgewicht, Haltungskontrolle und grobmotorische Abläufe – etwa durch physiotherapeutische Übungen oder neurophysiologische Behandlungskonzepte.
Die Logopädie befasst sich mit Auffälligkeiten in Sprache, Stimme, Sprechweise und Kommunikation. Bei Autismus liegt der Fokus häufig auf der Prosodie, also der Sprachmelodie, Lautstärke oder Betonung, sowie auf dem Erwerb kommunikativer Basiskompetenzen. Auch alternative Kommunikationsformen (z.B. unterstützte Kommunikation) können Teil der logopädischen Arbeit sein, um soziale Interaktion und Ausdrucksmöglichkeiten zu fördern.
Weitere Maßnahmen
Zur Therapie des Autismus werden unter anderem auch Musik-, Kunst-, Reit- und Delfintherapie eingesetzt. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen ist individuell sehr unterschiedlich und umstritten.
Sowohl im Privatbereich als auch am Arbeitsplatz sollten Rückzugsmöglichkeiten zur Reizabschirmung gegeben sein.
Kinderschutz
Kinder mit Autismus weisen ein erhöhtes Risiko auf, Opfer von Kindesmissbrauch zu werden. Zudem sind sie in Vermisstenfällen überproportional häufig betroffen. Es besteht ein erhöhtes Risiko für Ertrinkungsunfälle oder andere unfallbedingte Gefährdungen. Eine Schwierigkeit ist, dass vermisste autistische Kinder bei Auffinden teilweise nicht auf direkte Ansprache oder die Nennung ihres Namens reagieren.[6][7]
Weblinks
Quellen
- ↑ Newschaffer CJ et al.: The epidemiology of autism spectrum disorders. Annu Rev Public Health. 2007;28:235-58.
- ↑ GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence, Collaborators: Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet. 388 (10053): 1545–602. doi:10.1016/S0140-6736(16)31678-6. PMC 5055577. PMID 27733282.
- ↑ Thapar A, Rutter M. Genetic Advances in Autism. J Autism Dev Disord. 2021
- ↑ Montanari M et al. Autism Spectrum Disorder: Focus on Glutamatergic Neurotransmission. Int J Mol Sci. 2022
- ↑ Hernández-Díaz S et al. Risk of Autism after Prenatal Topiramate, Valproate, or Lamotrigine Exposure. N Engl J Med. 2024
- ↑ National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC): Autism & Wandering (abgerufen am 05.12.2025)
- ↑ Anderson et al.,Occurrence and Family Impact of Elopement in Children With Autism Spectrum Disorders, American Academy of Pediatrics, 2012