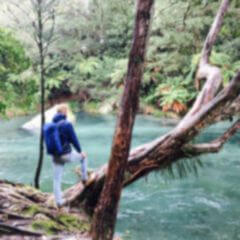Long-QT-Syndrom
Synonyme: LQS, LQTS, LQT-Syndrom
Englisch: Long QT syndrome
Definition
Das Long-QT-Syndrom ist eine Herzerkrankung mit pathologisch verlängertem QT-Intervall im EKG, die zur Gruppe der Ionenkanalerkrankungen (Kanalopathien) gehört.
ICD10-Code I49.8
Epidemiologie
Physiologie
Das Herz-Aktionspotential zeigt eine steile Aufstrichphase mit Overshoot bei +40mV (Phase 1), dem nach kurzer K+-abhängiger Repolarisation eine Plateauphase (Phase 2) folgt. Diese wird durch den Einstrom von Ca2+-Ionen aus dem Extrazellularraum und verzögerten K+-Ausstrom (IKS) verursacht. Der abschließende Ca2+-Ausstrom und die Öffnung verzögert aktivierter K+-Kanäle (IKS, IKR) repolarisieren die Zelle (Phase 3), die nach kurzer Nachhyperpolarisation das Membranruhepotential (Phase 4) annimmt.
Analog zum neurogenen Aktionspotential unterteilt sich die Refraktärphase (Phase 3) in eine:
- relative Refraktärzeit, innerhalb derer Nachdepolarisationen möglich sind, und eine
- absolute Refraktärzeit.
Ätiologie
Ätiologisch werden zwei Formen des LQT-Syndroms unterschieden:
- kongenitales (primäres) LQT-Syndrom und
- erworbenes (sekundäres) LQT-Syndrom
Kongenitales LQT
Das kongenitale LQT beruht auf einer mutationsbedingten Ionenkanalfunktionsstörung mit struktureller Veränderung eines Ionenkanals bzw. dessen Ankerproteinen (LQT5, s.u.). Gemäß der jeweiligen Mutation werden verschiedene Typen des Long-QT-Syndroms (LQT1-10) klassifiziert (siehe Tabelle). Am häufigsten betroffen sind die Gene KCNQ1 (30 - 35 %), KCNH2 (25 - 30 %) sowie SCN5A (5 - 10 %).[2][3]
| Typ | Gen | Genprodukt | Funktion |
|---|---|---|---|
| I* | KCNQ1 | α-Untereinheit des spannungsabh. Kaliumkanals KvLQT1 | Langsamer (slow) Repolarisationsstrom IKs |
| II | HERG/KCNH2 | α-Untereinheit des spannungsabh. Kaliumkanals HERG | Schneller (rapid) Repolarisationsstrom IKr |
| III** | SCN5A | Spannungsabhängiger Natriumkanal | Depolarisation |
| IV | ANK2 | Ankyrin-2 | Zytoskelettales Protein zur Verankerung von Ionenkanälen in Myozytenmembran |
| V | KCNE1 | ß-Untereinheit des spannungsabhängigen Kaliumkanals KvLQT1 | IKs |
| VI | KCNE2 | Regulatorische Untereinheit des HERG-Kanals und des KCNB1-Kanals | IKr |
| VII*** | KCNJ2 | Kaliumkanal-Untereinheit | IKs |
| u.a. |
*In Abhängigkeit vom Erbgang lässt sich das LQTI weiter untergliedern in:
- das Jervell-Lange-Nielsen-Syndrom mit Innenohrschwerhörigkeit durch strukturellen Defekt der Kaliumkanäle der Stria vascularis und
- das Romano-Ward-Syndrom ohne Innenohrbeteiligung.
**Das LQTIII ist vom Brugada-Syndrom abzugrenzen, das ebenfalls auf eine Mutation des SCN5- Gens zurückgeht.
***Das LQTVII wird auch als Andersen-Tawil-Syndrom bezeichnet.
Erworbenes LQT
Erworbene Formen können Arzneimittel-induziert sein, z.B. durch Klasse I- und III-Antiarrhythmika, verschiedene Antibiotika, Psychopharmaka oder infolge einer Hypokaliämie auftreten.[4] Weitere Medikamente, die zu einer Verlängerung der QT-Zeit führen, sind Antihistaminika wie Ebastin, Terfenadin und Astemizol. Auch Arzneistoffe, die bei COVID-19 eingesetzt wurden, wie Chloroquin, Hydroxychloroquin und Azithromycin, können zu einem LQT-Syndrom führen.
Bei einer Hypokaliämie kann die QT-Zeit durch Verschmelzung der T- und U-Wellen nicht bestimmbar sein - man spricht dann von einer "Pseudo-QT-Zeit-Verlängerung".
Risikofaktoren
Die o.a. therapeutischen Klassen führen meist in Kombination mit diversen Risikofaktoren zu einer Verlängerung der QT-Zeit. Zu den patientenindividuellen Risikofaktoren zählt zum Beispiel das weibliche Geschlecht. Kardiovaskuläre Erkrankungen erhöhen ebenso das Risiko. Hier sind Herzinsuffizienz, Herzhypertrophie, Diabetes mellitus, AV-Block und Bradykardie zu nennen. Zu den Risikofaktoren die einer Elektrolytstörung geschuldet sind, zählen die Hypokaliämie, die Hypomagnesiämie und die Hypokalzämie. Besonders bei Kindern muss man darauf achten, dass ein übermäßiger Konsum von Lakritz durch eine Hypokaliämie zu einem LQT-Syndrom führen kann.
Pathophysiologie
Der Pathomechanismus des LQT beruht auf einem Ionenkanal-Funktionsdefekt mit resultierender:
- Depolarisations- (Natriumkanal-Mutationen, LQT) bzw.
- Repolarisationsstörung (Kaliumkanaldefekte).
Im kardiomyozytenspezifischen Aktionspotential zeigt sich entsprechend eine Verlängerung von
- Plateauphase oder
- Refraktärphase.
Durch die verzögerte Refraktärität können Nachdepolarisationen innerhalb der vulnerablen Phase zu einer unphysiologischen Erregung benachbarter Zellen (ektope Erregungsbildung) mit der Folge lebensbedrohlicher ventrikulärer Tachykardien führen.
Klinik
Bereits korrigierte QT-Zeiten (QTc) von über 440 ms können pathologisch sein. Das klinische Beschwerdebild äußert sich in plötzlich auftretenden, häufig belastungsbedingten Torsades-de-pointes-Tachykardien mit
- allgemeinem Unwohlsein,
- Palpitationen,
- Angina pectoris,
- Synkopen und
- Schweißausbrüchen.
Komplikationen
Nicht behandelte ventrikuläre Tachykardien können in ein Kammerflimmern mit finalem Kreislaufstillstand übergehen.
Diagnostik
Der Erkrankung wird durch ein Ruhe- und ggf. Belastungs-EKG diagnostiziert. Maßgebliche Kriterien sind erhöhte
- QT-Zeit und
- frequenzkorrigierte QT-Zeit (QTC) nach Bazett, Hegglin oder Fridericia
- Männer > 450 ms
- Frauen > 470 ms.
Da es sich beim Long-QT-Syndrom um eine vererbbare Krankheit handelt, ist bei familiärem LQT die Familienanamnese hinweisgebend. Zudem besteht die Möglichkeit des molekulargenetischen Mutations-Nachweises in Leukozyten-DNA mittels PCR-Amplifikation und Sequenzierung der bekannten Risikogene. Als Probenmaterial dienen 2 - 5 ml EDTA-Blut.[2][5]
Therapie
Bei medikamentös induziertem LQT ist die Absetzung des jeweiligen Arzneimittels obligat.
Hypokaliämisch bedingte LQT sind durch Kalium-Substitution unter fortlaufender Kontrolle des Serumkaliumspiegels zu therapieren.
Die Therapie des LQS besteht in der Risikominimierung von Nachdepolarisationen durch Senkung der Herzfrequenz mittels:[1]
- nichtselektiver Betablocker (z.B. Nadolol, Propranolol)
- Mexiletin (bei weiterhin bestehender QTc-Verlängerung trotz Betablocker)
- Sympathektomie (linkskardiale sympathische Denervierung bei Therapieresistenz)
Bei therapierefraktären Beschwerden ist die Implantation eines Herzschrittmachers oder AICD indiziert.
Quelle
- ↑ 1,0 1,1 El-Battrawy I et al. Ionenkanalerkrankungen als Ursache für den plötzlichen Herztod im jungen Alter. Dtsch Arztebl Int 2024
- ↑ 2,0 2,1 Long-QT Syndrom (Langes-QT Syndrom, LQTS). Herz- und Diabeteszentrum NRW, abgerufen am 05.10.2024
- ↑ Long QT Syndrom. HGQN - Das humangenetische Qualitätsnetzwerk, abgerufen am 05.10.2024
- ↑ Risk Categories for Drugs that Prolong QT & induce Torsades de Pointes (TdP). CredibleMeds, abgerufen am 05.10.2024 - Suche nach Auslösern
- ↑ Diagnostikanbieter. HGQN - Das humangenetische Qualitätsnetzwerk, abgerufen am 05.10.2024
Literatur
- Haverkamp W. QT-Syndrome: Aspekte zur Pathogenese, molekularen Genetik, Diagnostik und Therapie. Dtsch Arztebl 1997