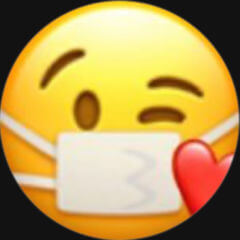Delir
von lateinisch: delirare – verrückt sein
Synonyme: Delirium, delirantes Syndrom
Englisch: delirium
Definition
Ein Delir ist ein komplexes hirnorganisches Syndrom. Es ist unter anderem durch eine qualitative Bewusstseinsstörung (Bewusstseinstrübung, veränderte Wahrnehmung) und eine verminderte Aufmerksamkeit gekennzeichnet.
Das Delir ist keine eigenständige Erkrankung, sondern ein Symptomkomplex, der durch vielfältige Ursachen ausgelöst werden kann.
ICD-10
- F05: Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt
- F05.0: Delir ohne Demenz
- F05.1: Delir bei Demenz
- F05.8: Sonstige Formen des Delirs
- F05.9: Delir, nicht näher bezeichnet
Einteilung
Es werden verschiedene Arten des Delirs unterschieden, wobei die Zuordnung nicht immer eindeutig ist:
- nach Ausprägung der Psychomotorik:
- hypoaktives Delir (etwa 30 %, insbesondere ältere Menschen)
- hyperaktives Delir (etwa 5 %, insbesondere Kinder)
- Mischtyp (etwa 65 % der Fälle)
- Nach Ätiologie und Situation:
- Fieberdelir
- (Alkohol-)Entzugsdelir (z.B. Delirium tremens)
- Delir auf Intensivstation
- postoperatives Delir
- pädiatrisches Emergence-Delir (Aufwachdelir)
Epidemiologie
Etwa 30 bis 40 % der über 65-Jährigen entwickeln während einer stationären Behandlung ein Delir. Unter allen intensivmedizinisch betreuten Personen kommt es bei bis zu 30 %, unter maschineller Beatmung bei bis zu 80 %, zu einem Delir.
Ätiologie
Die möglichen Ursachen des Delirs sind vielseitig. Prinzipiell können alle Faktoren, die körperlichen oder psychischen Stress auslösen, die Entstehung eines Delirs fördern. Häufig führt eine Kombination aus vorbestehenden Risikofaktoren und akuten Stressoren zur Entstehung eines Delirs.
Mögliche intrazerebrale Ursachen sind:
- neurodegenerative Erkrankungen (z.B. Demenzen, Parkinson-Syndrome)
- zerebrale Ischämien, Hirnblutungen
- Meningoenzephalitis
Zu den extrazerebralen Ursachen zählen:
- metabolische Störungen: z.B. Diabetes mellitus, Störungen des Elektrolythaushalts
- Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems: z.B. Myokardinfarkt, Schock
- (fieberhafte) Infektionen: z.B. Pneumonie, Sepsis
- toxikologische Faktoren: z.B. Entzug, Drogen, Medikamente
- psychosozialer Stress: z.B. Angst, Kontrollverlust
- andere körperliche Einschränkungen: z.B. Schmerzen, Schlafstörungen
- Operationen: insbesondere aufwendige Operationen wie Herzoperationen oder ein Ersatz des Hüftgelenks
- Exsikkose
- Anämie
Ein wichtiger Auslöser sind zudem Veränderungen im persönlichen Umfeld eines Patienten. Dazu gehören z.B. unvorhergesehene Ortswechsel (Aufnahme im Krankenhaus, Wechsel des Zimmers), unbekannte Umgebung, erschwerte Orientierung (z.B. durch fehlende Uhr im Zimmer und dauerhaft eingeschaltetes Licht), häufige Wechsel der Bezugspersonen oder soziale Isolation.
Eine Sonderform des Delirs ist das Alkoholentzugssyndrom (Delirium tremens), das beim Alkoholentzug auftreten kann.
Risikofaktoren
Wichtige allgemeine Risikofaktoren für ein Delir sind z.B.:
- Alter
- Demenz
- Alkohol-/Substanzmissbrauch
- Delir in der Vergangenheit
- schwere Vorerkrankungen
- psychische Erkrankungen
Pathogenese
Die pathogenetischen Prozesse bei Entstehung eines Delirs sind nicht vollständig geklärt. Eine entscheidende Rolle scheint die Beeinflussung des Hirnmetabolismus durch stressauslösende Faktoren zu spielen. Es kommt zu einem Ungleichgewicht der durch Neurotransmitter-vermittelten Transmission mit Überwiegen exzitatorischer Prozesse.
Symptome
Ein Delir beginnt i.d.R. akut und zeigt typischerweise einen fluktuierenden Verlauf. Dabei steht eine qualitative Bewusstseinsstörung im Vordergrund, das quantitative Bewusstsein kann dabei auch unbeeinträchtigt sein.
Die hypoaktive Verlaufsform ist schwerer zu erkennen als die hyperaktive Form, da die Motorik bei den Betroffenen deutlich reduziert ist.
Zu den Symptomen des Delirs gehören:
- qualitative Bewusstseinsstörung
- Orientierungsstörung zur
- Zeit
- Situation
- Ort
- eigener Person
- Agitiertheit
- psychomotorisch mit
- Nesteln
- Beschäftigungsdrang
- stereotypen, oft sinnlosen Bewegungen (Akathisie)
- ängstliche Agitiertheit
- psychomotorisch mit
- Halluzinationen
- Tremor
- Kreislaufstörungen
- Dysautonomie
- übermäßiges Schwitzen
- Hyperthermie
Diagnostik
Ein Delir ist ein medizinischer Notfall und erfordert eine schnelle und breite Diagnostik. Ein regelmäßiges Delir-Screening erlaubt eine frühe Diagnosestellung und adäquate Therapie.
Als Goldstandard zur Erfassung eines Delirs gilt die Confusion Assessment Method (CAM). Für die Diagnose auf Intensivstation gibt es ein angepasstes Screening, die sogenannte Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU). Die CAM-ICU berücksichtigt zusätzlich die Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) und somit den Sedierungsgrad.
Weitere Assessment-Werkzeuge in der Delir-Diagnostik sind:
- Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC)
- Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC)
- Delirium Detection Score (DDS)
- 4AT-Test
Tritt eine qualitative Bewusstseinsstörung neu auf, sollte eine schnelle Abklärung folgen. Hierzu gehören z.B.:
- Anamnese und Fremdanamnese
- körperliche und neurologische Untersuchung
- Erfassung der Vitalparameter, EKG
- regelmäßige Erfassung des psychopathologischen Befunds
- Notfalllabor
- ggf. EEG, zerebrale Bildgebung, erweiterte Infektionsdiagnostik, Liquorpunktion
Therapie
Die Therapie des Delirs richtet sich nach der auslösenden Ursasche. Unterstützend können dabei neben allgemeinen und präventiven Maßnahmen auch Medikamente zum Einsatz kommen. Für besondere Verlaufsformen (z.B. Delirium tremens) oder bei bestimmten Komorbiditäten (z.B. Parkinson, Demenz mit Lewy-Körperchen) gelten teils unterschiedliche Empfehlungen.
Behandlung der Ursachen
Die wichtigste Säule der Therapie ist die Behandlung der Ursache.
Allgemein sollte auf eine ausgewogene Flüssigkeitsbilanz geachtet werden. Mögliche Elektrolytstörungen und sonstige metabolische Störungen sollten behandelt werden. Darüber hinaus ist eine adäquate Sauerstoffversorgung, Schmerztherapie, Kreislaufstabilisierung wichtig. Nach Möglichkeit sollte die Gabe von Medikamenten mit delirogenem Potential unterbrochen oder reduziert werden.
Allgemeine Maßnahmen
Die üblichen präventiven Maßnahmen auch einen therapeutischen Effekt bei bereits bestehendem Delir. Es ist wichtig, eine möglichst strukturierte und vertraute Umgebung zu schaffen. Die Kommunikation mit den betroffenen Patienten sollte möglichst ruhig gestaltet werden. Dabei ist es sinnvoll, Personal- und Zimmerwechsel möglichst zu vermeiden. Zudem helfen die Regulierung des Schlafverhaltens bzw. des Tag-Nacht-Rhythmus, kognitive Stimulation und Hilfen zur Orientierung wie z.B. Brillen, Hörgerate und Uhren. Postoperativ können eine frühe Mobilisierung, enterale Ernährung und Entfernung von Drainagen präventiv wirken. Ebenso ist eine Sturzprophylaxe wichtig, um Verletzungen zu verhindern.
Unter Umständen müssen Maßnahmen zum Eigen- und Fremdschutz getroffen werden. Diese können sich jedoch selbst negativ auf die Entwicklung eines Delirs auswirken, weshalb eine genaue Nutzen-Risiko-Abwägung wichtig ist.
Medikamentöse Therapie
Eine medikamentöse Therapie wird möglichst nur beim Versagen der allgemeinen Maßnahmen und bei besonders schweren Verläufen (z.B. bei Halluzinationen) eingesetzt. Es ist wichtig zu beachten, dass eine medikamentöse Therapie lediglich symptomatisch wirkt und keine kausale Therapieoption ist.
Medikamente werden symptomorientiert und temporär eingesetzt. Je nach Patientin oder Patient sind individuell unterschiedliche Nebenwirkungen und Anwendungsbeschränkungen zu beachten.
Folgende Substanzen kommen in der Therapie des Delirs zum Einsatz:
- typische Antipsychotika, z.B. Pipamperon, Melperon, Haloperidol
- atypische Antipsychotika, z.B. Risperidon, Clozapin, Quetiapin
- Alpha-2-Agonisten (z.B. Clonidin)
- Betablocker
Beim Alkoholentzugsdelir werden typischerweise Benzodiazepine eingesetzt. Diese sollten bei älteren Patienten jedoch nicht als Mittel der 1. Wahl eingesetzt werden.
Medikamentöse Therapie bei Delir in der Palliativmedizin
| Anwendung | Arzneimittel | Applikation | Einzeldosis (mg) | Tagesmaximaldosis (mg) |
|---|---|---|---|---|
| Monotherapie | Haloperidol | p.o., s.c. | 0,5-2 | 10 |
| Olanzapin | s.l. | 5 | 15 | |
| Melperon | p.o. | 25 | 150 | |
| Pipamperon | p.o. | 12 | 80 | |
| Additive Therapie | Lorazepam | i.v. | 0,5-1 | 3 |
| Levomepromazin | p.o. | 15-30 | 90 |
nach Schwartz et al. (2023)[1]
Hinweis: Diese Dosierungsangaben können Fehler enthalten. Ausschlaggebend ist die Dosierungsempfehlung in der Herstellerinformation.
Prophylaxe
Die Prävention eines Delirs beinhaltet (falls möglich) die Modifikation von Risikofaktoren, die zu einem Delir führen können. Zudem können viele Faktoren der Therapie eines Delirs auch prophylaktisch wirken (siehe Therapie). Bei älteren Patienten kann eine nächtliche Melatoningabe das Risiko für ein Delir reduzieren. Diskutiert wird zudem eine mögliche präventive Wirkung einer präoperativen Gabe von Haloperidol bei Patienten mit einem sehr hohen Risiko für ein Delir.[2]
Quiz
Bildquelle
- Bildquelle für Flexikon-Quiz: © MARIOLA GROBELSKA / Unsplash
Quellen
- ↑ Schwartz J et al. Psychopharmakotherapie in der Palliativmedizin. Psychopharmakotherapie 2023; 30(2):40–6
- ↑ S3-Leitlinie Analgesie, Sedierung und Delirmanagement in der Intensivmedizin (DAS-Leitlinie 2020), AWMF-Registernummer: 001/012