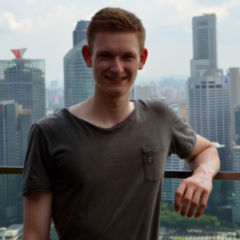Schenkelhalsfraktur
Synonyme: Schenkelhalsbruch, Oberschenkelhalsfraktur, Femurhalsfraktur
Englisch: fracture of the femoral neck
Definition
Die Schenkelhalsfraktur ist eine Fraktur des Oberschenkelhalses (Collum femoris).
Epidemiologie
Schenkelhalsfrakturen sind eine häufige Fraktur des alten Menschen. Die jährliche Inzidenz bei über 65-Jährigen beträgt ca. 600-900 pro 100.000.
Kinder sind nur sehr selten betroffen. Für sie gelten erhebliche Unterschiede bzgl. der Differenzialdiagnostik und der Therapie.
siehe auch: proximale Femurfraktur beim Kind
Ätiologie
Eine Schenkelhalsfraktur entsteht durch mechanische Krafteinwirkung (z.B. Drehung, Biegung, Abscherung) auf den Schenkelhals. Typischer Unfallhergang ist ein Sturz aus Standhöhe oder niedriger Sitzhöhe auf den Trochanter major oder eine forcierte Außenrotation des Beines (z.B. beim Stolpern). Auch eine Überbelastung bei zugrundeliegender Osteoporose oder Varusstellung des Schenkelhalses können eine Schenkelhalsfraktur bedingen. Seltene Ursache ist ein Hochrasanztrauma mit axialer Stauchung des Oberschenkels.
Risikofaktoren
Die Schenkelhalsfraktur steht häufig in Zusammenhang mit einer Osteoporose und ist daher für ältere Frauen sehr typisch. Männer sind im Gegensatz dazu weniger häufig von Schenkelhalsfrakturen betroffen. Das Frakturrisiko ist insbesondere bei Vorliegen einer Fallneigung (z.B. bei rezidivierenden Synkopen, Alkoholabusus, Sehstörungen) erhöht.
Einteilung
Eine Schenkelhalsfraktur kann aufgrund verschiedener Kriterien klassifiziert werden.
Einteilung nach Lokalisation
Grundsätzlich kann zwischen medialen und lateralen Schenkelhalsfrakturen unterschieden werden. Die medialen Schenkelhalsfrakturen werden nach Richtung der frakturauslösenden Krafteinwirkung in Adduktionsfrakturen und Abduktionsfrakturen unterteilt.
- Mediale Schenkelhalsfraktur (95 %): Die Fraktur liegt im medialen Anteil des Schenkelhalses. Durch die anatomischen Gegebenheiten bedingt liegen mediale Schenkelhalsfrakturen innerhalb der Gelenkkapsel des Hüftgelenks.
- Adduktionsfraktur: Der betroffene Femur liegt im Hüftgelenk in Varusstellung, die Frakturfragmente neigen zur Dislokation.
- Abduktionsfraktur: Der Femur liegt in Valgusstellung, die Frakturfragmente sind in den meisten Fällen ineinander verkeilt und neigen weniger zur Dislokation als bei Adduktionsfrakturen.
- Laterale Schenkelhalsfraktur (5 %): Die Fraktur liegt im lateralen Anteil des Schenkelhalses und liegt außerhalb der Gelenkkapsel.
AO-Klassifikation
Die AO-Klassifikation dient der Einteilung der Schenkelhalsfraktur nach Lokalisation und Dislokation:
- 31-B1: Fraktur subkapital, impaktiert oder nicht, wenig disloziert
- 31-B2: Fraktur transzervikal
- 31-B3: Fraktur subkapital, nicht impaktiert, disloziert
...nach Risiko der Perfusionsstörung des Femurkopfes
Das Risiko einer Perfusionsstörung des Femurkopfes wird anhand der Garden-Klassifikation beurteilt. Je kleiner die Kontaktfläche der Frakturfragmente und je größer die Dislokation, desto höher ist das Risiko einer Femurkopfnekrose. Unterschieden werden:
- Garden I (12 %): inkomplette, subkapitale Abduktionsfraktur (impaktiert, Aufrichtung der Kopftrabekel, Valgusstellung, nicht disloziert, intakte Perfusion)
- Garden II (20 %): vollständige Fraktur ohne Dislokation (keine Impaktierung, Unterbrechung der Trabekel ohne Abwinkelung, hintere Gelenkkapsel erhalten, intakte Perfusion)
- Garden III (48 %): vollständige Fraktur mit teilweiser Dislokation (mediale Kontaktfläche erhalten, Varusstellung, hintere Kapsel und Kortikalis potentiell verletzt, Perfusionsstörung)
- Garden IV (20 %): vollständige Fraktur mit kompletter Dislokation (kein Kontakt der Frakturfragmente, ungünstige Perfusionsprognose)
...nach mechanischen Gesichtspunkten
Die Pauwels-Klassifikation berücksichtigt den Winkel der Hauptfrakturlinie zur Horizontalen. Je größer der Winkel, desto höher ist das Risiko einer Dislokation und einer schlechten Heilung der Fraktur.
- Pauwels I: Winkel < 30° (Abduktionsfraktur in Valgusfehlstellung, günstige Heilungstendenz)
- Pauwels II: Winkel 30-50° (Adduktionsfraktur in Varusfehlstellung, abnehmende Heilungstendenz)
- Pauwels III: Winkel > 50° (Abscherfraktur, schlechte Heilungstendenz)
Die Angaben zur Pauwels-Klassifikation unterscheiden sich in der Literatur, teilweise wird Grad II mit 30–70° und Grad III mit >70° angegeben.
Symptomatik
In Abhängigkeit von der Art der Fraktur stehen klinisch unterschiedliche Aspekte im Vordergrund.
Adduktionsfrakturen zeigen das typische Bild einer Trias bestehend aus
- Fehlstellung des Beines in Außenrotation, wegen des Muskelzugs der am Trochanter major ansetzenden Musculi glutaei (Musculus gluteus maximus, Musculus gluteus medius, Musculus gluteus minimus)
- Verkürzung des Beines
- Schmerzen bei Bewegung(sversuch) im Hüftgelenk
Abduktionsfrakturen zeigen im Gegensatz dazu weniger stark ausgeprägte Symptome, da häufig trotz Fraktur eine hohe Reststabilität besteht. Oftmals sind Druckschmerzhaftigkeit und Schmerzen bei Stauchung des Hüftgelenks die einzigen klinischen Anhaltspunkte.
Prellmarken und Hämatome über der Frakturstelle können einen wichtigen Hinweis auf Art und Ausmaß des Traumas geben.
Diagnose
Die Diagnose ist in den meisten Fällen durch eine gezielte Anamnese, körperliche Untersuchung und Röntgenaufnahmen zu stellen.
Anamnese
Die Anamnese sollte in Anbetracht einer möglicherweise notwendigen Operation folgende Punkte gezielt berücksichtigen:
- Klärung des genauen Unfallmechanismus
- vorbestehende Beschwerden/Erkrankungen am Hüftgelenk
- Vorerkrankungen wie z.B.
- Osteoporose
- Atherosklerose
- maligne Neoplasien
- Erkrankungen von Herz, Leber und Nieren
- Einnahme von Medikamenten, insbesondere Gerinnungshemmer (z.B. ASS, Clopidogrel)
Körperliche Untersuchung
Eine Verkürzung des Beins, Druck- und Bewegungsschmerz über Hüfte und angrenzenden Gelenken sollten überprüft werden. Im Rahmen der Frakturdiagnostik ist das Tasten der Fußpulse und die Prüfung der Sensibilität und Motorik von Bein und Fuß genau zu überprüfen und zu dokumentieren.
Bildgebende Verfahren
In jedem Fall benötigte Röntgenaufnahmen sind:
- Tiefe Beckenübersichtsaufnahme
- Proximaler Oberschenkel/Hüftgelenk axial
Eine Computertomographie ist erst durchzuführen, wenn die konventionellen Röntgenaufnahmen keine sichere und vollständige Beurteilung erlauben. Eine Einblutung in die Gelenkkapsel und die damit verbundene Spannung der Kapsel kann mit einer Sonographie des Hüftgelenks dargestellt und vor einer eventuellen Punktion beurteilt werden.
Differenzialdiagnosen
Therapie
Die definitive Therapie der Schenkelhalsfraktur kann je nach Art und Ausmaß der Fraktur konservativ oder operativ erfolgen. In der Regel wird eine chirurgische Versorgung angestrebt.
Konservative Behandlung
Eine konservative Behandlung ist indiziert bei:
- Patienten mit ausgeprägter Herzinsuffizienz, Bronchopneumonie und signifikanter Malnutrition
- allgemeine oder lokale Kontraindikationen gegen eine Operation
- impaktierten, stabilen Frakturen und nur geringer Abwinkelung des Femurkopfes in der Axialaufnahme
- dislozierter Fraktur bei Vorliegen von Gebrechlichkeit, Bettlägrigkeit und Demenz
Konservative Maßnahmen umfassen eine adäquate Schmerztherapie, eine Entlastung für mindestens 5 Wochen mit anschließender Mobilisation unter physiotherapeutischer Betreuung. Bei Bedarf kann zur Entlastung der Gelenkkapsel eine Punktion mit Drainage erfolgen.
Entscheidend ist eine medikamentöse Thromboseprophylaxe. Erfolgt sie nicht, haben Hüftfrakturen ein hohes Risiko unerkannter (45 %) oder manifester tiefer Beinvenenthrombosen (1-11 %), symptomatischer Lungenembolien (3-13 %) und fataler Lungenembolien (1-7 %).
Falls die Fraktur sekundär disloziert, sollte mit der Operation nicht gewartet werden.
Operative Behandlung
Die operative Behandlung ist in den meisten Fällen aufgrund besserer Stabilität und kürzerer Immobilisation vorzuziehen. Instabile Frakturen (z.B. Adduktionsfrakturen) werden fast immer operativ versorgt. Bei konservativer Versorgung ist die Komplikationsrate (Pseudarthrose, Hüftkopfnekrose, Thrombembolie, Dekubitus) deutlich höher als bei der operativen Versorgung. Die Wahl des Verfahrens (Osteosynthese oder Endoprothese) wird dabei individuell gestellt.
Osteosynthese
Eine hüftkopferhaltene Osteosynthese wird bevorzugt bei:
- impaktierten, nicht dislozierten Frakturen (im Sinne einer prophylaktischen Osteosynthese)
- jüngeren Patienten (i.d.R. < 65-70 Jahren)
- hohem Aktivitätsniveau des Patienten (unabhängig von Alter und Frakturtyp)
- guter Knochenqualität
- frischer Fraktur (< 24 Stunden)
- fehlender Arthrose
- gut reponierbarer Fraktur
- ipsilateraler Parese
Eine frühzeitige Osteosynthese innerhalb von 6-24 Stunden halbiert das Hüftkopfnekroserisiko. Der Zugang erfolgt über das Tuberculum innominatum. Es existieren verschiedene Verfahren:
- Schraubenosteosynthese
- dynamische Hüftschraube (DHS)
- Marknagelosteosynthese: proximaler Femurmarknagel und Gamma-Nagel
Endoprothese
Eine Endoprothese ist insbesondere bei:
- älteren Patienten
- niedrigem Aktivitätsniveau
- fortgeschrittener Osteoporose
- ausgeprägter Coxarthrose
- pathologischer Fraktur
- nicht ausreichend reponierbarer Fraktur
Der Zugang erfolgt meist von anterolateral (nach Watson-Jones) oder transmuskulär (nach Bauer). Dabei kann eine Duokopfprothese oder eine Totalendoprothese (TEP) implantiert werden. Letztere wird bevorzugt bei jüngeren Patienten und bei Coxarthrose angewendet. Die Behandlung mittels Endoprothese sollte möglichst frühzeitig erfolgen (innerhalb von 24 bis maximal 48 Stunden).
Nachsorge
Postoperativ sollte eine Thrombosepropyhlaxe (für 4-5 Wochen) und die Gabe von Analgetika fortgesetzt werden. Auf Elektrolytentgleisungen (z.B. Hyponatriämie und Hypokaliämie) muss geachtet werden. Neben einer regelmäßigen Wundkontrolle und adäquate Lagerung sind Röntgenkontrollen direkt postoperativ, nach Belastung und vor Verlegung indiziert. Soweit möglich ist eine Frühmobilisation sowie eine regelmäßige physiotherapeutische Anleitung zu isometrischen Übungen und zur Atemtherapie (Pneumonieprophylaxe) anzustreben. Bei jüngeren Patienten kann für 6 Wochen eine schmerzadaptierte Teilbelastung in Frage kommen, bei älteren Patienten ist eine Vollbelastung indiziert.
Prognose
Ungefähr ein Viertel aller Patienten nach proximaler Femurfraktur versterben innerhalb eines Jahres nach dem Unfall. Häufig haben die Patienten größere Schwierigkeiten mit Aktivitäten des täglichen Lebens im Vergleich zu gleichaltrigen Personen. Bei konservativer Behandlung beträgt das Risiko einer späten Femurkopfnekrose bis zu 20 %.
Nach Durchführung einer Osteosynthese versterben ca. 20-30 % der Patienten im 1. Jahr nach der Operation. Eine sekundäre Dislokation tritt in ca. 2-7 % d.F. auf. Weitere Risiken sind eine Hüftkopfnekrose und eine Pseudarthrose. Im Verlauf erhalten 10-20 % der Patienten eine Endoprothese.
Nach Implantation einer Endoprothese versterben ebenfalls ca. 20-30 % der Patienten im 1. postoperativen Jahr. Risiken sind insbesondere eine Prothesenlockerung und Protheseninfektionen.
Prävention
Präventiv sollte insbesondere bei alten Menschen das Sturz- und Frakturrisiko abgeschätzt und durch geeignete Maßnahmen reduziert werden. Hilfreich sind Basismaßnahmen, die auch präventiv bei Osteoporose empfohlen werden, z.B. körperliche Aktivität, Verbesserung der Muskelkraft und Koordination, Vermeidung von Immobilisation, altersgerechte Wohnungseinrichtung und Überprüfung der Sehfähigkeit. Bei Hochrisikopatienten können Hüftprotektoren verordnet werden.
Literatur
- S2-Leitlinie Schenkelhalsfraktur 2015, abgerufen am 24.09.2020