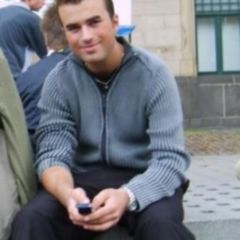Direkte orale Antikoagulanzien
Abkürzung: DOAK
Synonyme: direkte orale Antikoagulantien, neue orale Antikoagulantien (NOAK), neue orale Antikoagulanzien
Englisch: new oral anticoagulants, NOAC
Definition
Direkte orale Antikoagulanzien, kurz DOAK, ist der Oberbegriff für eine Gruppe von gerinnungshemmenden Arzneistoffen, die direkt gegen bestimmte Gerinnungsfaktoren wirken und oral eingenommen werden können. Nach der Markteinführung dieser Substanzen wurde alternativ auch der Begriff neue orale Antikoagulanzien (NOAK) verwendet.
Begriffserklärung
Bisher standen als gerinnungshemmende Medikamente zur oralen Einnahme nur Vitamin-K-Antagonisten (Cumarin-Derivate, in Deutschland vor allem das Marcumar®) zur Verfügung. "Orale Antikoagulation" war daher gleichbedeutend mit Marcumarisierung. Acetylsalicylsäure (Aspirin®) und andere Thrombozytenaggregationshemmer können zwar ebenfalls geschluckt werden, sind aber keine Antikoagulanzien, da sie nicht in die plasmatische Gerinnung eingreifen.
Die Wirkungsweise der klassischen Antikoagulanzien ist indirekt: Heparin wirkt, indem es die Affinität von Antithrombin zum Thrombin und zum Faktor Xa verstärkt. Vitamin K-Antagonisten hemmen die Produktion von Gerinnungsfaktoren in der Leber. Daher stellen die DOAK ein neues Wirkungsprinzip dar.
Eine Umdeutung des Akronyms NOAK ist "Nicht-Vitamin-K-antagonistische Orale Antikoagulanzien" (non vitamin K antagonist oral anticoagulants, NOAC).
Einteilung
DOAK vom Anti-FIIa-Typ (Thrombinhemmer)
- Dabigatran (Pradaxa®)
- Ximelagatran (Exanta®, orales Prodrug von Melagatran, nicht mehr zugelassen)
DOAK vom Anti-FXa-Typ (Faktor-Xa-Hemmer, Xabane)
- Apixaban (Eliquis®)
- Edoxaban (Lixiana®)
- Otamixaban
- Rivaroxaban (Xarelto®)
Vor- und Nachteile
Als Hauptvorteile der DOAK sind die einfache Anwendung und der Wegfall regelmäßiger Gerinnungskontrollen zu nennen. Ob der Verzicht auf Gerinnungskontrollen medizinisch begründet ist oder den Teil einer Marketingstrategie darstellt, ist allerdings umstritten.[1]
In einer Reihe von Studien erfüllten DOAK nicht die in sie gesetzten Erwartungen. Zum Teil wurden eine Zunahme von thromboembolischen Ereignissen und Blutungen sowie eine erhöhte Mortalität festgestellt. Für Patientengruppen mit folgenden Erkrankungen lies sich kein Benefit gegenüber Vitamin-K-Antagonisten nachweisen:[2]
- kryptogener Schlaganfall
- linksventrikuläre Thrombose
- zerebrale Sinusvenenthrombose
- Zustand nach Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI)
- Thrombophilie aufgrund eines Antiphospholipid-Syndroms
- Vorhofflimmern in Verbindung mit rheumatischen Erkrankungen
- terminale Nierenerkrankung
Ein wesentlicher Nachteil war anfangs das Fehlen eines Antidots, das zur Normalisierung der Gerinnung bei Blutungskomplikationen oder vor Notfalleingriffen verwendet werden kann. Inzwischen (2024) sind verschiedene solcher Antidots zugelassen.
Labordiagnostische Methoden, die eine Restwirkung oder Akkumulation von DOAK nachweisen könnten, sind nicht weit verbreitet, auch dies kann sich nachteilig auswirken.
Notfallmanagement
Da die Substanzen kurze Halbwertszeiten haben, kann bei nicht bedrohlichen Blutungen zugewartet werden. Bei schweren Blutungen wird versucht, das Gerinnungspotential durch Gabe von Prothrombinkomplex-Konzentraten (PPSB) oder gerinnungsaktivem Plasma allgemein anzuheben. Eine Übersichtsarbeit zum Vorgehen bei Notfällen unter DOAK-Therapie wurde 2012 im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht und 2021 aktualisiert.[3] Eine weitere Übersicht ist 2015 in Thrombosis and Haemostasis erschienen (frei zugänglich, englisch).[4]
Gegen Dabigatran wurde Anfang 2016 mit Idarucizumab ein spezifischer Antagonist zugelassen. Es handelt sich um ein humanisiertes Antikörperfragment, das Dabigatran mit hoher Affinität bindet.
Als Antagonisten gegen FXa-Inhibitoren wurden Andexanet alfa und Ciraparantag entwickelt. Bei Andexanet alfa handelt es sich um gentechnisch hergestelltes Faktor X-Fragment, das eine Bindungsstelle für die Inhibitoren aufweist, aber keine Gerinnungsaktivität hat. Es wurde im Mai 2018 in den USA und im April 2019 in der EU als Antidot für Rivaroxaban und Apixaban zugelassen[5].
Labordiagnostik
Für Wirkungskontrollen der DOAK eignen sich Routine-Gerinnungstests nur wenig. Empfohlen werden
- für DOAK vom Anti-FIIa-Typ die Ecarin-Clotting-Time (ECT) oder eine auf das jeweilige Medikament kalibrierte, verdünnte Thrombinzeit
- für DOAK vom Anti-FXa-Typ eine auf das jeweilige Medikament kalibrierte Anti-Faktor Xa-Aktivität
Einfluss auf Gerinnungsparameter
Durch die neuen oralen Antikoagulanzien verliert die jahrzehntelang gültige Formel: Marcumar® = INR, Heparin = aPTT ihre Gültigkeit. Schon das niedermolekulare Heparin stellte diesbezüglich eine gewisse Herausforderung dar, da es auch in therapeutischer Dosierung (Vollheparinisierung) die aPTT nicht oder nur wenig verlängert.
- DOAK vom Anti-IIa-Typ verlängern vor allem die aPTT, Faktor-Xa-Hemmer vermindern stärker den Quick. In höherer Dosierung werden beide Parameter beeinflusst[6].
- Mit der Fibrinogen-Messung (Methode nach CLAUSS) interferieren beide Stoffgruppen nur wenig.
- Die Antithrombin-Messung kann sowohl durch Thrombinhemmer als auch durch Faktor-Xa-Hemmer gestört sein, es werden ggf. falsch hohe Werte ermittelt. Dies ist abhängig vom eingesetzten Assay und muss im Labor erfragt werden.
- D-Dimere werden durch Immunoassays bestimmt; diese Methode wird durch Antikoagulanzien nicht beeinflusst.
- Die Messung von Lupus-Antikoagulans wird durch DOAK beeinflusst, die Untersuchung kann falsch positiv werden.
Podcast

Quellen
- ↑ Arzneitelegramm a-t 2014; 45: 25-6
- ↑ Bejjani A et al. When direct oral anticoagulants should not be standard treatment: jacc state-of-the-art review. J Am Coll Cardiol 2024
- ↑ Steiner T: Neue direkte Orale Antikoagulanzien: Was im Notfall zu beachten ist. Dtsch Arztebl 2021; 118(1-2): A-25
- ↑ Weitz JI, Pollack CV: Practical management of bleeding in patients receiving non-vitamin K antagonist oral anticoagulants. Thromb Haemost 2015; 114: 1113–1126
- ↑ Deutsche Apotheker Zeitung: Xarelto-Antidot in den USA zugelassen
- ↑ Simeon L, Nagler M, Wuillemin WA: Neue orale Antikoagulanzien - Einfluss auf Gerinnungstests. Dtsch med Wochenschr 2014; 139(03): 94-99
Bildquelle
- Bildquelle Podcast: © Midjourney