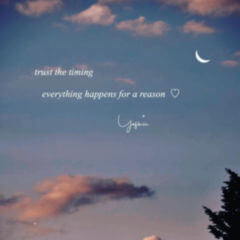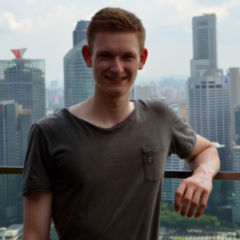Bulimie
von altgriechisch: βουλιμία ("bulimia") - Ochsenhunger, Heißhunger
Synonyme: Hyperorexie, Ess-Brech-Sucht, Bulimia nervosa, "Freß-Kotz-Sucht"
Englisch: bulimia, bulimarexia, binge-purge syndrome
Definition
Die Bulimie, auch Bulimia nervosa, ist eine psychogene Essstörung, die durch wiederkehrende Essattacken gekennzeichnet ist, die sich mit gegenregulierenden Maßnahmen (Purging) abwechseln.
Epidemiologie
Die Lebenszeitprävalenz wird mit etwa 2 % beziffert, wobei eine hohe Dunkelziffer vermutet wird. Der Altersgipfel liegt bei etwa 18 Jahren.[1] Frauen sind deutlich häufiger betroffen.
Ätiologie
Die Ursachen für Bulimie sind in der Regel multifaktoriell bedingt. Beteiligt sind:[2]
- genetische Faktoren (hohe Zwillingskonkordanzraten[3], deutliche familiäre Häufungen)
- Persönlichkeitsmerkmale, insbesondere Neurotizismus[4]
- soziokulturelle Faktoren (z.B. Zugehörigkeit zu Mittel-/Oberschicht oder Risikoberufen wie Modebranche, familiäre Belastungen durch Streit oder Konflikte)
Sehr häufig entwickelt sich eine Bulimie aus einem Diätversuch heraus. In vielen Fällen geht der Bulimie auch eine Anorexia nervosa voraus.
Symptome
Es besteht eine gedankliche Ambivalenz mit einerseits attackenartiger Gier nach Nahrungsaufnahme, andererseits starker Furcht vor Gewichtszunahme und dem ständigen Gefühl, zu dick zu sein (Körperschemastörung). Dies äußert sich in:
- wiederholt auftretenden unregelmäßige Essanfällen, dabei rasche Aufnahme übermäßiger Nahrungsmengen bis zum Völlegefühl
- während der Attacken Gefühl von Kontrollverlust, danach Schamgefühle
- gegenregulierende Maßnahmen (Purging) und übertriebene Gewichtskontrolle, z.B.:
- selbstinduziertes Erbrechen, insb. nach den Essattacken
- Einnahme von gewichtsmindernden Pharmaka (Diuretika, Abführmittel, L-Thyroxin)
- bei Diabetikern oft Unterdosierung von Insulin (Insulin-Purging)
- übermäßige sportliche Aktivität
- strenge Diäten und Fastenkuren
Das Körpergewicht ist meist normwertig, es sind jedoch auch Über- oder Untergewicht möglich. Oft zeigen sich Gewichtsschwankungen in kurzen Abständen.
Häufig finden sich psychiatrische Komorbiditäten (Substanzmissbrauch, Depression, Angststörungen, Borderline-Persönlichkeitsstörung, ADHS). Das Suizidrisiko ist aufgrund des hohen Leidensdrucks der Betroffenen erhöht.
Sekundäre körperliche Veränderungen
Durch ein starkes Purging-Verhalten kann es zu folgenden Störungen kommen:
- Symptome der Mangelernährung, u.a. Vitaminmangel
- Störungen des Elektrolythaushalts (z.B. Hypokaliämie)
- Hormonelle Veränderungen
- Gastritis, Ösophagitis sowie Mallory-Weiss-Risse; Boerhaave-Syndrom als seltene Komplikation
- Karies aufgrund der Schmelzerosion durch Kontakt mit Magensäure
- Entzündung oder Hypertrophie der Speicheldrüsen (Sialadenose)
- Schwielen an den Fingern (Russell-Zeichen)
Diagnostik
Die Diagnose wird in der Regel klinisch anhand bestimmter Diagnosekriterien gestellt. Dabei kommt dem ausführlichen Gespräch mit den Betroffenen eine zentrale Bedeutung zu. Bei Minderjährigen sollte die Eigenanamnese durch das Gespräch mit den Erziehungsberechtigten ergänzt werden.
Die Basisdiagnostik umfasst EKG, Echokardiographie, Sonografie der Nieren, sowie Laboruntersuchungen (Blutbild, Elektrolyte). Sie ist darauf gerichtet, eventuelle Folgeschäden an Herz oder Nieren festzustellen.
Diagnosekriterien nach DSM-V
Die Diagnosekriterien des DSM-V umfassen:
- wiederholte Episoden von Essattacken mit folgenden Merkmalen
- Verzehr einer übermäßigen Nahrungsmenge in einem abgegrenzten Zeitraum (z.B. innerhalb von 2 Stunden)
- Gefühl des Kontrollverlustes über das Essverhalten
- wiederholte Anwendung unangemessener kompensatorischer Maßnahmen, um einer Gewichtszunahme entgegenzusteuern, z.B. selbstinduziertes Erbrechen, Missbrauch von Laxantien, Diuretika oder anderen Medikamenten, Fasten oder übermäßige körperliche Bewegung
- durchschnittliche Frequenz der Essanfälle und der kompensatorischen Maßnahmen ≥ 1x/Woche über ≥ 3 Monate
- übermäßiger Einfluss von Figur und Körpergewicht auf die Selbstbewertung
- die Störung tritt nicht ausschließlich als Teil einer Anorexia-nervosa-Episode auf
Diagnosekriterien nach ICD-11
Die Diagnosekriterien des ICD-11 unterscheiden sich nur unmaßgeblich von denen des DSM-V:
- wiederkehrende Essanfälle (≥ 1×/Woche über ≥ 1 Monat), definiert als ein bestimmter Zeitraum (z.B. 2 Stunden) des Kontrollverlustes über das Essverhalten mit Aufnahme von deutlich mehr und/oder anderer Nahrung als gewöhnlich
- wiederholt unangemessene kompensatorische Gegenmaßnahmen, um eine Gewichtszunahme zu verhindern (≥ 1×/Woche über ≥ 1 Monat), z.B. selbstinduziertes Erbrechen, Medikamenteneinnahme (z.B. Laxanzien, Insulin-Purging bei Personen mit Diabetes), übertriebene Aktivität/Sport.
- übermäßige Beschäftigung mit Körperform und Gewicht
- großer Leidensdruck oder signifikante Beeinträchtigung in verschiedenen Lebensbereichen.
- Ausschluss einer Anorexia nervosa
Therapie
Die Therapie erfolgt in der Regel ambulant. Eine stationäre Einweisung ist bei der Bulimie nur dann nötig, wenn medizinische Komplikationen auftreten, die Betroffenen sehr stark psychisch belastet sind oder die ambulante Behandlung sich als unwirksam erweist. Ein wichtiges Ziel der Langzeittherapie bei Bulimie besteht darin, das Essverhalten zu ändern.
Primär erfolgt eine Psychotherapie. Die beste Evidenz besteht dabei für die kognitive Verhaltenstherapie, aber auch eine interpersonelle Therapie ist möglich.
Medikamente spielen bei der Behandlung der Bulimie eine untergeordnete Rolle. Ergänzend können jedoch Antidepressiva verabreicht werden. Insbesondere das SSRI Fluoxetin wird aufgrund seiner langen Halbwertszeit bevorzugt (erbrochene Tabletten beeinflussen Serumspiegel weniger), aber auch Monoaminoxidasehemmer werden eingesetzt. Dies bietet sich vorwiegend bei einer begleitenden Depression an. Die erforderliche Dosierung ist meist höher als bei reiner Depression, die Wirkung zeigt eine gewisse Latenz.
Prognose
Die Langzeitfolgen von Bulimia nervosa können sehr vielfältig sein. Nur ein geringer Teil der Patienten begibt sich in Therapie. Für diese gelten folgende prognostischen Eckwerte:
- Etwa 50 % der Patienten werden langfristig symptomfrei
- bei etwa 20 % setzt sich die Bulimie als chronischer Verlauf fort
- bei etwa 30 % kommt es zu gelegentlichen Rückfällen
Leitlinie
- S3-Leitlinie Diagnostik und Therapie der Essstörungen der DGPM und DGKJP im AWMF-Register. Stand 31.05.2018, aktuell (2024) in Überarbeitung.
Einzelnachweise
- ↑ Leucht, Förstl (Hrsg.). Kurzlehrbuch Psychiatrie und Psychotherapie. 2. Auflage. Thieme Verlag Stuttgart, 2018.
- ↑ Bode et al. (Hrsg.). Psychosomatische Grundversorgung in der Pädiatrie. 1. Auflage. Thieme Verlag Stuttgart, 2016.
- ↑ Fichter und Noegel. Concordance of bulimia nervosa in twins. International Journal of Eating Disorders, 1990.
- ↑ Sonnenmoser. Essstörungen und Persönlichkeit: Unterschätzter Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen. Ärzteblatt, 2010.