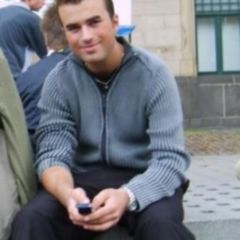Tumorlyse-Syndrom
Synonym: Tumor-Lyse-Syndrom
Englisch: tumor lysis syndrome
Definition
Das Tumorlyse-Syndrom, kurz TLS, ist eine häufig lebensbedrohende Stoffwechselentgleisung, die bei plötzlicher Zerstörung einer größeren Anzahl von Tumorzellen auftreten kann. Durch den Tumorzerfall gelangt eine große Menge an Metaboliten in den Blutkreislauf. Prädestiniert für die Entstehung eines Tumorlyse-Syndroms sind rasch progrediente Tumore.
Das Gegenteil eines Tumorlyse-Syndroms ist die Tumor-Flare-Reaktion (TFR).
Ätiopathogenese
Wie normale Körperzellen enthalten Tumorzellen eine Vielzahl von Elektrolyten, Metaboliten und anderen stoffwechselaktiven Verbindungen. Im Fokus stehen hier vor allem Calcium, Kalium, Phosphat und Harnsäure. Im Rahmen einer Chemotherapie kommt es zu einer plötzlichen Zerstörung vieler Tumorzellen, die durch das Zytostatikum hervorgerufen wird. Als direkte Folge des Zelluntergangs werden massenhaft Inhaltsstoffe der Zellkörper ins Blut freigesetzt und zirkulieren im Kreislauf. Durch die Überflutung des Organismus mit diesen Verbindungen kann es zu einer lebensbedrohlichen Entgleisung des Stoffwechsels kommen.
Das durch eine Tumorlyse am stärksten belastete Organ ist die Niere, da diese für die Ausscheidung vieler Metabolite zuständig ist. Nicht selten ist ein vollkommener Verlust der Nierenfunktion und eine lebenslange Dialysepflichtigkeit die Folge eines Tumorlyse-Syndroms.
Auslösende Tumoren
Einige maligne Raumforderungen sind besonders empfindlich gegenüber Zytostatika. Diese Krebsarten zeichnen sich durch eine schnelle Mitoserate, also schnelles Wachstum aus - hier besteht eine erhöhte Gefahr eines Tumorlyse-Syndroms. Dazu zählen u.a.:
- Burkitt-Lymphom
- Lymphoblastisches B-Zell-Lymphom
- T-ALL
- andere akute Leukämien und aggressive Lymphome
Ein mäßiges Risiko besteht bei:
- chronischer lymphatischer Leukämie (CLL)
- Plasmozytom
- kleinzelligem Bronchialkarzinom (SCLC)
- Keimzelltumoren
- Mammakarzinom
- Neuroblastom
Verantwortliche Stoffe
Der wichtigste nephrotoxische Metabolit ist die übermäßig anfallende Harnsäure. Sie entsteht durch die Verstoffwechselung der aus den Tumorzellen stammenden Nukleinsäuren. Die großen Mengen an anfallender Harnsäure können nicht mehr vollständig über die Niere ausgeschieden werden. Folge ist eine Auskristallisierung der Harnsäure mit anschließender Anreicherung im Nierenparenchym (akute Uratnephropathie) und erhöhtem Risiko eines Nierenversagens.
Des Weiteren steigt durch den Zellzerfall der Kaliumspiegel im Blut. Normalerweise liegt Kalium im Intrazellulärraum zwar in hoher Konzentration vor, im Blutplasma ist es aber nur sehr niedrig konzentriert. Ferner sieht man einen Anstieg der Lactatdehydrogenase (LDH) und des anorganischen Phosphats. Die Hyperphosphatämie führt zur Kalzium-Phosphat-Präzipitation in den Nieren, sodass eine sekundäre Hypokalzämie entsteht.
Zeitpunkt
Ein Tumorlyse-Syndrom tritt oft zu Beginn oder nach Umstellung einer Chemotherapie auf, wenn es zur Zerstörung einer großen Menge Tumorzellen innerhalb kurzer Zeit kommt. Am häufigsten kann ein Tumorlyse-Syndrom in einem Zeitraum von etwa 48 bis 72 Stunden (2 bis 3 Tage) nach Beginn der Behandlung beobachtet werden, seltener innerhalb von wenigen Stunden.[1]
Bei einer Strahlentherapie ist ein Tumorlyse-Syndrom deutlich seltener zu erwarten, da die malignen Zellen hier langsamer untergehen.
Klassifikation
Anhand der Klassifikation nach Cairo-Bishop unterscheidet man:[2]
- Labortechnisches Tumorlyse-Syndrom:
- Harnsäure > 8 mg/dl oder > 25 % Anstieg gegenüber dem Wert vor Therapiebeginn
- Kalium > 6 mmol/l oder > 25 % Anstieg
- Phosphat > 1,45 mmol/l oder > 25 % Anstieg
- Kalzium < 1,75 mmol/l oder > 25 % Abfall
- Beginn innerhalb von 3 Tagen nach Beginn bis 7 Tage nach Ende der Chemotherapie
- Klinisches Tumorlyse-Syndrom:
- Labortechnisch nachgewiesenes Tumorlyse-Syndrom plus:
- Kreatinin > 1,5-Fache der oberen Normgrenze
- oder Herzrhythmusstörungen bzw. plötzlicher Herztod
- oder epileptischer Anfall
Therapie
- ausreichende Flüssigkeitszufuhr
- Gabe von Rasburicase gegen den überhöhten Harnsäurespiegel
- Ausgleich der aus dem Gleichgewicht geratenen Elektrolyte und Metabolite
Die Harnalkalisierung ist umstritten. Die Löslichkeit von Harnsäure wird zwar verbessert, aber die der Abbauprodukte von Allopurinol, Xanthin und Hypoxanthin verschlechtert. Weiterhin wird die Hypokalzämie durch vermehrte Kalziumphosphat-Präzipitationen verstärkt.
Prophylaxe
- ausreichende Flüssigkeitszufuhr
- Verzicht auf nierenschädigende Medikamente (z.B. Aminoglykoside)
- Verzicht auf Medikamente, die den Kalium-, Phosphat- oder Harnsäurespiegel erhöhen (z.B. ACE-Hemmer)
- Vermeiden einer Hyperkalzurie (v.a. Verzicht auf Thiaziddiuretika)
- Langsamer Beginn der Chemotherapie (geringe Durchflussrate), ggf. Vorphasetherapie mit Dexamethason und Cyclophosphamid
- Allopurinol: Urikostatikum
- Rasburicase: Urikolytikum, nicht in Kombination mit Allopurinol
Quellen
Literatur
- Belay et al.: Tumor Lysis Syndrome in Patients with Hematological Malignancies Journal of Oncology, 2017