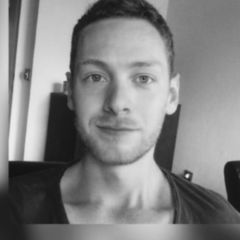Diskoider Lupus erythematodes
von griechisch: δίσκος ("diskos") - Scheibe
Synonyme: chronisch diskoider Lupus erythematodes, CDLE, Lupus erythematodes chronicus discoides
Englisch: discoid lupus erythematosus
Definition
Der diskoide Lupus erythematodes, kurz DLE, ist ein Subtyp des kutanen Lupus erythematodes (CLE). Es handelt sich um die häufigste Form des kutanen Lupus erythematodes.
Epidemiologie
Der diskoide Lupus erythematodes kommt weltweit vor. Seine jährliche Inzidenz liegt bei etwa 5-10 Fällen pro 100.000 Einwohner. Die Angaben schwanken jedoch, da in älteren Studien meist nicht zwischen den verschiedenen LE-Formen differenziert wurde. Frauen sollen nach manchen Quellen etwa 3x häufiger betroffen sein als Männer, nach anderen Quellen etwa gleich häufig. Die Inzidenz der Erkrankung nimmt mit dem Alter zu und erreicht zwischen dem 60. und 69. Lebensjahr ihren Gipfel.[1] Bei Afrikanern kommt die Erkrankung häufiger vor.
Ursachen
Der diskoide Lupus erythematodes ist eine Autoimmundermatose, deren genauer Pathomechanismus bislang (2018) noch nicht geklärt ist. Neben Umweltfaktoren (z.B. ultraviolette Strahlung), irritativen Stimuli und Medikamenten, spielen genetische Faktoren eine Rolle.
Symptome
Beim diskoiden Lupus erythematodes sind die Effloreszenzen bevorzugt an lichtexponierten Hautarealen wie Kopf, Gesicht, Ohren und behaarter Kopfhaut lokalisiert. Es können auch andere Körperregionen betroffen sein, wie das Dekolleté oder die Streckseiten der Extremitäten. Hautreizungen (z.B. reibender Hemdkragen) können Erkrankungsherde hervorrufen, was man als Köbner-Phänomen bezeichnet.
Die Erkrankung äußert sich durch rötliche, scheibenförmige Hautareale, die häufig, aber nicht immer, mit festhaftenden Schuppen und Krusten belegt sind. Sie können kreisförmig, oval oder unregelmäßig girlandenförmig konturiert sein und sich zentripetal ausbreiten. Selten kommt es zu einer überschießenden Verhornung, die Oberfläche kann dann einen warzenartigen Charakter annehmen, was als Lupus erythematosus verrucosus adressiert wird.
Die Herde sind randbetont. Typisch für den CLE ist die hypopigmentierte, narbige Abheilung im Zentrum der Effloreszenzen mit Atrophie der Haut. Hyperpigmentierungen und Teleangiektasien kommen ebenfalls vor. Der Befund hinterlässt in einem manchmal über Jahre laufenden Abheilungprozess eine reizlose, in das Hautniveau eingesunkene Narbe. Liegt der Herd im Bereich der behaarten Kopfhaut, entwickelt sich darüber hinaus eine bleibende Alopezie.
Die Effloreszenzen weisen bei der klinischen Untersuchung in der Entzündungszone eine gesteigerte Berührungsempfindlichkeit (Hypersensitivität) auf.
Histologie
Pathohistologisch zeigt sich eine Atrophie der Epidermis mit Orthohyperkeratose und follikulärer Keratose. Im Stratum basale kommt es zu einer Degeneration der Stammzellen mit zahlreichen Einzelzellnekrosen, die sich als eosinophile Zellreste darstellen. Im oberen Korium sieht man als Zeichen der Immunreaktion ein perivasales Infiltrat aus Lymphozyten sowie einen Abbau der Kollagenfasern und elastischen Fasern.
Diagnostik
In der Hautbiopsie zeigt sich unter direkter Immunfluoreszenz das typische Lupusband, eine Anreicherung von IgA, IgG, IgM sowie Komplementfaktor C1 und C3 an der Grenze zwischen Dermis und Epidermis. Auf unbefallener Haut ist der Test negativ.
Differentialdiagnosen
Therapie
- Lichtschutz (Sunblocker, bedeckende Kleidung)
- Glukokortikoide (intraläsional oder mit Okklusivverband)
- Chloroquin
Schlägt die Standardtherapie nicht an, kommen u.a. Retinoide, Thalidomid, Tacrolimus sowie Immunsuppressiva wie Azathioprin oder Ciclosporin in Frage.
Prognose
Die Prognose des diskoiden Lupus erythematodes ist - mit Ausnahme der Beeinträchtigung der Hautästhetik - insgesamt gut. Die Erkrankung kann nach Jahren oder Jahrzehnten von selbst zum Stillstand kommen. Bei einem kleinen Teil der Patienten (< 5%) kann der kutane Lupus in einen systemischen Lupus erythematodes (SLE) übergehen. Sehr selten entwickelt sich auf alten Narbenbezirken ein Plattenepithelkarzinom.
Quellen
- ↑ Sudumpai Jarukitsopa et al.: Epidemiology of Systemic Lupus Erythematosus and Cutaneous Lupus in a Predominantly White Population in the United States Arthritis Care Res (Hoboken). 2015 May; 67(6): 817–828. doi: 10.1002/acr.22502 PMCID: PMC4418944 NIHMSID: NIHMS639302 PMID: 25369985
Weblinks
- Russo G, Tehrany YA. Discoid Lupus Erythematosus. N Engl J Med 2024 - Fallbericht mit Abb.