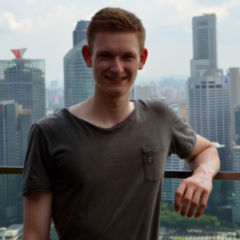Α-Melanozyten-stimulierendes Hormon
Synonym: α-Melanotropin
Englisch: alpha-melanocyte stimulatory hormone
Definition
Als α-Melanozyten-stimulierendes Hormon, kurz α-MSH, bezeichnet man ein immunregulatorisches Peptidhormon aus der Gruppe der Melanocortine. Es wird sowohl in der Adenohypophyse als auch in der Haut durch limitierte Proteolyse aus Proopiomelanocortin (POMC) bzw. dessen Spaltprodukt ACTH gebildet.
Biochemie
α-MSH entsteht durch Abspaltung der letzten 13 aminoterminalen Aminosäuren aus ACTH. Das katalysierende Enzym ist die Prohormon-Convertase 2 (PC2). α-MSH wird nicht nur in der Adenohypophyse, sondern auch in Keratinozyten, Melanozyten und dermalen Zellen (Fibroblasten, Endothelzellen) synthetisiert, insbesondere nach Stimulation mit proinflammatorischen Zytokinen oder UV-Licht.
α-MSH bindet an Melanocortin-Rezeptoren (MC), heterodimere G-Protein-gekoppelte Rezeptoren mit 7 Transmembrandomänen. Dabei unterscheidet man zwischen 5 verschiedenen Melanocortin-Rezeptoren:
| Rezeptor | Lokalisation |
|---|---|
| MC-1 | Melanozyten, maligne Melanomzellen, Keratinozyten, Fibroblasten, Endothelzellen |
| MC-2 | Gehirn, Adipozyten |
| MC-3 | Gehirn, Darm, Plazenta |
| MC-4 | Gehirn, Darm |
| MC-5 | Gehirn, Nebenniere, Adipozyten, Skelettmuskel, Knochenmark, Milz, Thymus |
Nach Rezeptoraktivierung kommt es zur Aktivierung der Adenylatzyklase mit Erhöhung der intrazellulären cAMP-Konzentration.
Funktion
In der Haut besitzt α-MSH vielfältige Funktionen, u.a.:[1]
- Stimulation der Melanogenese u.a. durch Aktivierung der Tyrosinase
- Modulation der Proliferation und Differenzierung von Keratinozyten
- Regulation der Zytokinproduktion von Endothelzellen und Fibroblasten
- Synthese der fibroblastischen Kollagenase
Bei Immunzellen (v.a. Monozyten und Makrophagen) bewirkt es eine verminderte Synthese von proinflammatorischen Zytokinen, während es die Bildung von antiinflammatorischen Faktoren (z.B. Interleukin-10) stimuliert. Außerdem wirkt α-MSH stark antipyretisch.
Im sog. Melanocortin-System stellt α-MSH ein anorexigenes Regulationshormon dar: Im gesättigten Zustand nach Nahrungsaufnahme überwinden u.a. Leptin und Insulin die Blut-Hirn-Schranke und aktivieren im Nucleus arcuatus sog. POMC-Neurone. Diese produzieren α-MSH, welches an MC-4 in Nucleus paraventricularis bindet. Die Folgen sind ein reduziertes Appetitgefühl und ein gesteigerter Energieverbrauch. Während Fastenperioden sorgt u.a. Ghrelin als auch die geringere Leptinkonzentration für eine Hemmung der POMC-Neurone. Als Gegenspieler fungieren außerdem Neurone, die das Agouti-ähnliche Peptid (AgRP) sowie Neuropeptid Y synthetisieren.[2]
Pharmakologie
Derzeit (2020) existieren zwei MC-Agonisten:
- Afamelanotid: synthetisches Analogon von α-MSH, bindet an MC-1
- Bremelanotid: Derivat von α-MSH, bindet an MC-3 und MC-4
Quellen
- ↑ Luger TA et al. The role of alpha-melanocyte-stimulating hormone in cutaneous biology, J Investig Dermatol Symp Proc. 1997 Aug;2(1):87-93, abgerufen am 17.03.2020
- ↑ Baldini G, Phelan KD The melanocortin pathway and control of appetite-progress and therapeutic implications, J Endocrinol. 2019 Apr 1;241(1):R1-R33, abgerufen am 17.03.2020