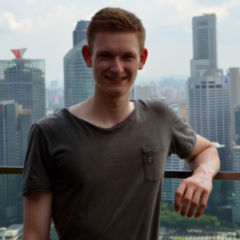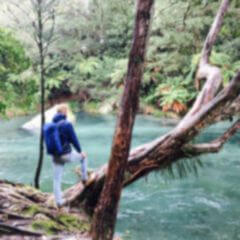Shigellose
nach dem japanischen Arzt und Bakteriologen Shiga Kiyoshi (1871-1957)
Synonyme: Shigellenruhr, Bakterienruhr
Definition
Die Shigellose ist eine infektiöse Diarrhö, die durch Shigellen verursacht wird.
Erreger
Es sind vier humanpathogene Arten von Shigellen bekannt (Gruppe A bis D). Die Arten sind geographisch unterschiedlich verteilt. In Mitteleuropa werden ca. 80 % aller Ruhrerkrankungen durch Gruppe D-Shigellen verursacht ("Shigella sonnei").
| Spezies | Serogruppe | Anzahl der Serovare | Vorkommen |
|---|---|---|---|
| Shigella dysenteriae | A | 10 | Tropen und Subtropen |
| Shigella flexneri | B | 13 | weltweit, auch Mitteleuropa |
| Shigella boydii | C | 15 | Vorderasien und Nordafrika |
| Shigella sonnei | D | 1 | weltweit, auch Mitteleuropa |
Da die Erreger relativ säurestabil sind und die Magenpassage gut überstehen, weisen sie eine sehr geringe Infektionsdosis auf, sodass ca. 200 Bakterien ausreichen, um eine klinische Symptomatik auszulösen. Shigellen sind jedoch nicht besonders umweltresistent und sterben in der Außenwelt schnell ab.
Pathogenese
Das Erregerreservoir der Shigellen ist der Mensch. Die Übertragung erfolgt fäkal-oral, vor allem durch kontaminiertes Wasser und andere Nahrungsmittel. Die Inkubationszeit beträgt 2 bis 5 Tage, bei Shigella dysenteriae auch bis zu 10 Tagen.
Shigellen führen primär zu einer invasiven Enteritis, die sich vornehmlich im terminalen Ileum und Kolon abspielt. Durch die Wirkung von bakteriellen Shigatoxinen kommt es zu sekundären Schädigungen und Komplikationen der Erkrankung. Die Folge sind ausgedehnte Ulzerationen, die widerrum zu Blutungen und Tenesmen führen. Diese Toxine sind hitzelabil und wirken entero-, zyto- und neurotoxisch.
Epidemiologie
In Deutschland treten jährlich etwa 1.000 Fälle der Shigellenruhr auf. Der größte Teil der Erkrankungen sind importiert (z.B. Indien, Nordafrika). Die Shigellose weist einen hohen Manifestationsindex auf und infizierte Patienten sind sehr kontagiös.
Ein gehäuftes Auftreten der Shigellose ist bei Hygieneproblemen festzustellen.
Klinik
Die Erkrankung beginnt mit einer kolikartigen Diarrhö. Bei leichten Verläufen ist der Stuhl wässrig ("weiße Ruhr"), bei schweren Verläufen ist ein blutig-schleimiger Stuhl üblich ("rote Ruhr"). Die häufigen Stuhlentleerungen sind von Tenesmen begleitet.
Als Komplikationen kann es bei ausgiebiger Mukosaschädigung zur Gastrointestinalblutung, bei Durchwanderung auch zur Perforation und Peritonitis kommen. Selten kommt es nach der Diarrhö zur Entwicklung einer reaktiven Arthritis oder eines Reiter-Syndroms. Bei Kleinkindern können zudem Krampfanfälle, Koma und selten septische Verläufe auftreten.
Nach einer Shigellenruhr ist das gehäufte Auftreten eines hämolytisch-urämischen Syndroms beobachtet worden. Dieses ist wahrscheinlich durch die immunogenen Wirkungen der Shigatoxine vermittelt.
Histopathologie
Am Anfang erscheint die Darmschleimhaut gerötet und entzündlich geschwollen ("katarrhalische Ruhr"). Bei schweren Infektionen kommt es zur Bildung von Pseudomembranen und Schleimhautnekrosen ("pseudomembranös-nekrotisierende Ruhr") mit tiefen Ulzerationen. Im Verlauf zeigen sich histologische Ähnlichkeiten zum akuten Schub einer Colitis ulcerosa.
Labordiagnostik
Direkter Erregerachweis
Für den direkten Nachweis der Shigellen werden diese angezüchtet und anhand ihrer besonderen Eigenschaften differenziert. Die Gattung wird mithilfe eines polyvalenten Antiserums sowie in der biochemischen Differenzierung bestimmt. Die Einteilung in die vier Spezies beruht auf einer Kombination biochemischer und antigener Eigenschaften. Eine feinere Erregertypisierung ist durch molekularbiologische Verfahren (PCR) möglich.
Material
Da Shigellen in einer Stuhlprobe nach wenigen Stunden absterben, wird die Entnahme eines rektalen Abstriches mit einem Wattebausch oder die Nutzung eines Spezialnährmediums empfohlen.
Eine Beratung mit dem kooperierenden mikrobiologischen Institut ist in Zweifelsfällen immer anzuraten.
Indirekter Erregernachweis
Der Nachweis von Antikörpern gegen Shigellen hat nur eine geringe Aussagekraft bezüglich der Diagnosestellung einer Shigellose. Zum einen besteht eine Kreuzreaktivität zu Escherichia coli, zum anderen steigt der Titer oftmals erst nach Abklingen der klinischen Symptomatik an. Darüber hinaus ist der Titeranstieg meist nur sehr gering. Jedoch kann im Rahmen der Ursachenabklärung einer postinfektiösen Arthritis der Nachweis von Shigellen-Antikörpern indiziert sein. Der Test wird zur Zeit (2021) in Deutschland von vielen Laboren nicht mehr angeboten.
Referenzbereich
| Spezies | Norm |
|---|---|
| Shigella dysenteriae 1 und 2 | < 1:50 |
| Shigella sonnei | < 1:25 |
Therapie
Neben einer ausreichenden Rehydratation und dem Ausgleich der Elektrolyte wird die Gabe eines Antibiotikums empfohlen, da dadurch die Krankheitsdauer und die Keimausscheidung reduziert werden. Vor Beginn der Antibiotikatherapie sollte in jedem Fall ein Antibiogramm erfolgen, da Mehrfachresistenzen durch Resistenzplasmide gehäuft vorkommen. Je nach Resultat wird mit Ciprofloxacin oder Azithromycin therapiert.
Verlauf
Die unkomplizierte Infektion endet in der Regel nach 4 bis 7 Tagen. Die Erregerausscheidung dauert jedoch länger. Schwere Verläufe kommen vor allem bei Kleinkindern, alten Menschen und Patienten mit Immunschwäche vor.
Meldepflicht
Nach § 7 Abs. 1 IfSG besteht eine namentliche Labormeldepflicht bei direktem oder indirektem Nachweis von Shigella sp.
Zudem besteht nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 IfSG eine Arztmeldepflicht bei einem Verdacht und Erkrankung an einer akuten mikrobiellen Gastroenteritis oder Lebensmittelintoxikation meldepflichtig, wenn:
- eine Beschäftigung im Lebensmittelverkehr bzw. in Küchen für Gemeinschaftseinrichtung vorliegt oder
- 2 oder mehr Erkrankungen mit anzunehmendem epidemischen Zusammenhang auftreten
ICD10-Codes
- A03: Shigellose
- A03.0 : Shigellose durch Shigella dysenteriae inkl.: Shigellose durch Shigellen der Gruppe A
- A03.1 : Shigellose durch Shigella flexneri inkl.: Shigellose durch Shigellen der Gruppe B
- A03.2 : Shigellose durch Shigella boydii inkl.: Shigellose durch Shigellen der Gruppe C
- A03.3 : Shigellose durch Shigella sonnei inkl.: Shigellose durch Shigellen der Gruppe D
- A03.8 : Sonstige Shigellosen
- A03.9 : Shigellose, nicht näher bezeichnet inkl.: Bakterielle Dysenterie o.n.A.
Literatur
- Laborlexikon.de; abgerufen am 04.05.2021