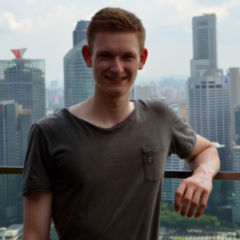DiGeorge-Syndrom
nach dem amerikanischen Pädiater Angelo Mari DiGeorge (1921 - 2009)
Synonyme: kongenitale Thymusaplasie, Di-George-Syndrom, Mikrodeletionssyndrom 22q11, CATCH-22-Syndrom, velokardiofaziales Syndrom
Definition
Das DiGeorge-Syndrom ist eine angeborene Defektimmunopathie mit Defekt der T-Lymphozyten und Aplasie/Hypoplasie des Thymus. Es ist das häufigste Mikrodeletions-Syndrom des Menschen.
Epidemiologie
Ätiologie
Dem DiGeorge-Syndrom liegt eine Mikrodeletion auf dem langen Arm von Chromosom 22 (Genlokus 22q11.2) zugrunde. Dabei geht Erbinformation in einem Umfang von etwa 3 Mb verloren.
Diese Deletion entsteht in 90 bis 95 % der Fälle durch nicht-allelische meiotische Rekombination während der Spermatogenese oder Oogenese. In den restlichen Fällen wird die Deletion autosomal-dominant weitervererbt. Meist sind ca. 30 Gene betroffen, wobei unter anderem die Gene TBX1 und CRKL für die Phänotypentstehung verantwortlich gemacht werden.[2] TBX1 kodiert für einen bei der Embryonalentwicklung bedeutsamen Transkriptionsfaktor. CRKL kodiert für eine Proteinkinase, die in die Kaskade von Wachstumsfaktoren und Zellmigrationsregulatoren (z.B. Reelin) eingebunden ist.
Pathogenese
Grundlage des DiGeorge-Syndroms ist ein gestörter Entwicklungsablauf der 3. und 4. Schlundtasche. Daraus resultiert ein Fehlbildungssyndrom mit Hypoplasie des Thymus und der Nebenschilddrüsen, angeborenen Herzfehlern und einer Gesichtsdysmorphie.
Symptomatik
Die Symptomatik wird – in Anspielung auf den gleichnamigen Roman von Joseph Heller – unter dem Akronym CATCH-22-Syndrom zusammengefasst:
- Cardiac abnormality
- Abnormal facies
- Thymic aplasia
- Cleft palate
- Hypocalcemia/Hypoparathyroidism
- Mikrodeletion auf Chromosom 22
Die Ausprägung der Symptomatik ist im Einzelfall unterschiedlich. Beobachtet werden:
- rezidivierende Infektionen mit Pilzen und Viren
- tetanische Krämpfe (Hypocalcämie bei Hypoparathyreoidismus)
- angeborene Herzfehler bzw. Fehlbildungen der großen Blutgefäße (Fallot-Tetralogie, Ventrikelseptumdefekt, aberrante Arteria subclavia)
Die Gesichtsdysmorphie weist mehrere Komponenten auf:
- breite und kurze Nase
- fischartiger Mund
- dysplastische Ohren
- Mikrognathie
- antimongoloide Lidachsen
- Hypertelorismus
Diagnostik
Die Kombination aus chronischer Hypocalcämie und rezidivierenden Infektionen bereits im Säuglingsalter sind wegweisend. Bei Erkennen der Gesichtsdysmorphie erhärtet sich der Verdacht. Bei Blutuntersuchungen fällt eine verminderte Anzahl von T-Lymphozyten auf.
Therapie
Die Therapie des DiGeorge-Syndroms richtet sich maßgeblich nach dem Schweregrad der Symptomatik. Die Immundefizienz kann sich nach den ersten Lebensmonaten zurückbilden, jedoch auch schwerwiegend sein. Auftretende Infektionen werden nach Möglichkeit mit Antibiotika/Antimykotika behandelt.
Die Hypocalcämie wird durch die Gabe von Cholecalciferol behandelt.
Liegt ein schweres DiGeorge-Syndrom mit sehr schlecht beherrschbaren Infektionen vor, kann eine Knochenmarkstransplantation erwogen werden, welche einen Versuch zur Etablierung funktionierender Immunzellen darstellt. Eine weitere Therapieoption stellt die Thymustransplantation dar.
- ↑ Panamonta et al.: "Birth Prevalence of Chromosome 22q11.2 Deletion Syndrome: A Systematic Review of Population-Based Studies" Journal of the Medical Association of Thailand, 2016
- ↑ Davies E: "Immunodeficiency in DiGeorge Syndrome and Options for Treating Cases with Complete Athymia" Frontiers in Immunology, 2013