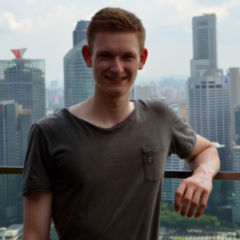Bálint-Syndrom
nach dem österreichisch-ungarischen Neurologen Rezső Bálint (1874-1929)
Synonym: Bálint-Holmes-Syndrom
Definition
Als Bálint-Syndrom bezeichnet man ein schwerwiegendes neuropsychiatrisches Syndrom, das durch die Trias einer Simultanagnosie, einer optischen Ataxie und einer okulomotorische Apraxie gekennzeichnet ist.
Historie
Das Syndrom wurde 1909 erstmalig durch den österreichisch-ungarischen Neurologen und Psychiater Rezső Bálint in einer Fallstudie beschrieben.[1]
Epidemiologie
Es handelt sich um ein seltenes Syndrom, das im Rahmen weniger Fallbeschreibungen erfasst ist. Inzidenzdaten sind nicht verfügbar. Meist sind Erwachsene betroffen, jedoch sind auch pädiatrische Fälle beschrieben.[2]
Ätiologie
Das Bálint-Syndrom tritt zumeist nach bilateralen Läsionen im posterioren Parietallappen auf. Seltener sind bilaterale parietookzipitale, basalganglionäre oder frontale Defekte ursächlich. Oft ist dabei die rechte Hemisphäre stärker betroffen.[3]
Mögliche Läsionsursachen sind:[3][4]
- Hirninfarkte (häufigste Ursache), insbesondere Posterior-Media-Grenzzoneninfarkte
- Schädel-Hirn-Traumata
- Hirntumoren, insbesondere Schmetterlingsgliome
- PRES
- hypoxische Hirnschäden, z.B. nach Reanimation, perinataler Hypoxämie
- neonatale Hypoglykämie
- neurodegenerative Erkrankungen (Morbus Alzheimer mit posteriorer kortikaler Atrophie, Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung, kortikobasale Degeneration)
- Enzephalitiden (HIV-Enzephalitis, PML, NMDA-Rezeptor-Enzephalitis)
- zerebrale Toxoplasmose
Klinik
Das Bálint-Syndrom ist gekennzeichnet durch eine Trias aus:[3]
- Simultanagnosie: Unfähigkeit, mehr als ein Objekt gleichzeitig wahrzunehmen. Der Betroffene kann hierdurch beispielsweise bei Bildpräsentation einen Wald nicht als solchen erfassen, obwohl er die einzelnen Bäume als solche erkennt.
- optischer Ataxie: Unfähigkeit, optisch gesteuerte Zielbewegungen auszuführen (z.B. visuell gesteuertes Greifen, Zeigen). Anderweitig gesteuerte Zielbewegungen (z.B. propriozeptiv am eigenen Körper, akustisch) können intakt oder defekt sein.
- okulomotorischer Apraxie: Unfähigkeit zu Willkürsakkaden mit gestörter Objektfixierung. Sie kann zwei Formen annehmen: entweder ist ein Lösen des Blickes von einem fixierten Objekt erschwert (sogenannte spasmodische Fixation), oder es kann überhaupt kein Objekt fixiert werden. Beide Apraxieformen können auch im Wechsel auftreten.
Je nach Ursache der Störung können die Einzelsymptome unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Auch können zusätzliche Symptome assoziiert sein, bspw. ein Hemineglect, Gesichtsfelddefekte oder andere Agnosien.
Das Zusammenwirken der neuropsychiatrischen Defekte führt zu einer schweren Einschränkung der Betroffenen im Alltag. Insbesondere das Lesen und die räumliche Orientierung sind stark erschwert oder gar unmöglich. Oft entsteht der Eindruck, die Betroffenen seien tunnelsichtig oder gar blind.
Diagnostik
Es handelt sich vornehmlich um eine Diagnose aus neuropsychiatrischer Testung und systematischer Verhaltensbeobachtung. Mögliche Testverfahren sind:[3][5]
| Teilstörung | Testverfahren |
|---|---|
| Simultanagnosie | Prüfung der Simultanwahrnehmung
|
| Optische Ataxie | Prüfung visuell gesteuerter Greif- und Zeigebewegungen
|
| Okulomotorische Ataxie | Prüfung der okulären Fixierung und der Fähigkeit des Wechselns zwischen fixierten Objekten, Prüfung von Willkürsakkaden
|
Ferner sollte eine Ursachendiagnostik (z.B. per cMRT) erfolgen.
Die Abgrenzung von Sehstörungen kann schwierig sein, da die okulomotorische Apraxie und die Simultanagnosie die Durchführung ophthalmologischer Tests erschwert. Es kann versucht werden, eine Visusminderung per Einzelsehzeichen oder mittels optokinetischer Streifenmuster auszuschließen. Ein Peripherskotom ("Tunnelblick") sollte via Perimetrie ausgeschlossen werden. Ist dies nicht möglich, kann getestet werden, ob reflektorische Sakkaden auf bewegte Objekte im peripheren Gesichtsfeld noch erhalten sind.
Therapie
Die Therapie richtet sich nach der Ursache. Ansonsten stehen rehabilitative und unterstützende Maßnahmen im Vordergrund, deren Effektivität jedoch nur wenig untersucht ist.
Leitlinie
- S2k-Leitlinie "Diagnostik und Therapie von Neglect und anderen Störungen der Raumkognition" im AWMF-Register. Deutschen Gesellschaft für Neurologie, 2023.
Einzelnachweise
- ↑ Bálint: "Seelenlähmung des “Schauens”, optische Ataxie, räumliche Störung der Aufmerksamkeit" Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie, 1909.
- ↑ Philip SS, Mani SE, Dutton GN. "Pediatric Balint's Syndrome Variant: A Possible Diagnosis in Children" Case Reports in Ophthalmological Medicine, 2016.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Kerkhoff, Heldmann: "Bálint-Syndrom und assoziierte Störungen. Anamnese - Diagnostik - Behandlungsansätze." Der Nervenarzt, 1999.
- ↑ Arvin Parvathaneni, Joe M Das: "Balint Syndrome" StatPearls, 2023.
- ↑ S2k-Leitlinie "Diagnostik und Therapie von Neglect und anderen Störungen der Raumkognition" im AWMF-Register. Deutschen Gesellschaft für Neurologie, 2023.