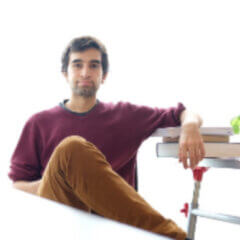Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung
Synonyme: Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, Aufmerksamkeitsdefizitstörung, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, ADS, Hyperkinetisches Syndrom, HKS, Zappelphilipp-Syndrom
Englisch: attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, attention deficit disorder, ADD
Definition
Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, ist eine neurobiologische Entwicklungsstörung, die vor allem bei Kindern auftritt und häufig bis ins Erwachsenenalter persistiert. Sie macht sich u.a. durch Konzentrationsstörungen, motorische Hyperaktivität und gesteigerte Impulsivität bemerkbar. Die motorische Hyperaktivität ist dabei als fakultatives Symptom anzusehen. Ausprägung und Schwergrad der Symptomatik nehmen tendenziell mit zunehmendem Alter der Patienten ab.[1]
Nomenklatur
Neben der Bezeichnung Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung finden sich in der Literatur auch der Begriff Aufmerksamkeitsdefizitstörung, kurz ADS. Teilweise wird er synonym verwendet, um zum betonen, dass bei den Betroffenen als Symptom primär die Aufmerksamkeitsstörung, nicht die Hyperaktivität im Vordergrund steht. Als eigene Krankheitsentität hat sich die Bezeichnung ADS bislang (2025) nicht durchgesetzt.
An anderen Stellen wird der Begriff Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom verwendet, um den beschreibenden Charakter des Phänomens zu betonen und den pathologisierenden Aspekt des Wortes "Störung" zu vermeiden.
Epidemiologie
Die Angaben zur Prävalenz der ADHS variieren je nach den zugrundeliegenden Diagnosekriterien. Die DSM-5-Kriterien sind weniger strikt als die Diagnosekriterien nach ICD-10, entsprechend sind die Fallzahlen bei ersterem höher.
Gemäß DSM-5 wird die Prävalenz einer situationsübergreifenden Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung bei Kindern im Schulalter auf etwa 5 % geschätzt. Die Störung kann – teils in abgemilderter Form – bis in das Erwachsenenalter hinein bestehen bleiben. Residualsymptome liegen bei bis zu 65 % der Betroffenen vor.[1]
Ätiologie
Die genauen Ursachen, die zu einer ADHS führen, sind bislang (2025) weitgehend ungeklärt. Generell wird von einer multifaktoriellen Pathogenese ausgegangen, bei der sowohl biologische als auch psychosoziale Faktoren eine Rolle spielen.
Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass genetische Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Die Erblichkeit von ADHS liegt bei etwa 76–80 %. Damit ist ADHS eine der am stärksten genetisch determinierten psychiatrischen Erkrankungen. Etwa ein Drittel der hereditären Fälle ist durch genetische Varianten erklärbar, der Rest durch Gen-Umwelt-Interaktionen und epigenetische Mechanismen.
Pränatale und perinatale Risikofaktoren wie Nikotinkonsum, Alkoholkonsum oder Drogenkonsum der Mutter während der Schwangerschaft, Frühgeburtlichkeit, niedriges Geburtsgewicht sowie andere Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen können das ADHS-Risiko erhöhen, insbesondere bei bereits genetisch prädisponierten Kindern.[2] [3][4] [5]
Diagnose
Die Diagnostik baut auf der allgemeinen Basisdiagnostik psychischer Störungen des Kindes- und Jugendalters auf. Die Diagnose erfolgt in der Regel durch einen spezialisierten Facharzt. In den meisten Fällen geschieht dies durch einen (Kinder- und Jugend-)psychiater, Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin. Aber auch Fachärzte für Neurologie oder erfahrene Hausärzte und Allgemeinmediziner können die Diagnose einer ADHS stellen.
Die Diagnose einer ADHS ist anspruchsvoll. Informationen aus mehreren Quellen durch eine Kombination von Eigen- und Fremdanamnese der Vertrauenspersonen des Kindes, Interviews, klinischer sowie psychiatrischer und psychologischer Untersuchungen sind essentiell. Hilfreich sind standardisierte Fragebögen und validierte Checklisten. Diese Informationen werden dann genutzt, um eine Diagnose nach ICD-10 bzw. DSM-5 zu stellen.
Eine differentialdiagnostische Abgrenzung und Überprüfung psychischer komorbider Störungen ist zwingend erforderlich.[6] Insbesondere Störungen des Sozialverhaltens sind häufig (etwa 50 % der Betroffenen).
... nach ICD-10
Die ICD-10 beschreibt die Symptome von ADHS anhand mehrerer diagnostischer Kriterien (G1–G7).[7] Diese Kriterien erfassen die Bereiche Unaufmerksamkeit, Überaktivität und Impulsivität, sowie den Beginn und die Auswirkungen der Störung. Die Diagnose setzt voraus, dass die Symptome über mindestens sechs Monate bestehen, in mehreren Lebensbereichen auftreten und zu einer deutlichen Beeinträchtigung führen.
| Kriterium | Beschreibung und Symptome |
|---|---|
| G1. Unaufmerksamkeit | Mindestens 6 Monate lang ≥ 6 der folgenden Symptome von Unaufmerksamkeit in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmaß:
|
| G2. Überaktivität | Mindestens 6 Monate lang ≥ 3 der folgenden Symptome von Überaktivität in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmaß:
|
| G3. Impulsivität | Mindestens 6 Monate lang ≥ 1 der folgenden Symptome von Impulsivität in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmaß:
|
| G4. Beginn der Störung | Beginn der Störung vor dem siebten Lebensjahr. |
| G5. Symptomausprägung | Die Kriterien müssen in mehr als einer Situation erfüllt sein, z.B. zuhause und in der Schule oder an einem anderen Ort, wo das Kind beobachtet werden kann.
(Der Nachweis situationsübergreifender Symptome erfordert meist Informationen aus mehreren Quellen; Elternberichte allein sind oft unzureichend.) |
| G6. Beeinträchtigung | Die Symptome aus G1–G3 führen zu deutlichem Leiden oder zu einer Beeinträchtigung der sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsfähigkeit. |
| G7. Ausschlusskriterien | Die Störung erfüllt nicht die Kriterien für:
|
... nach DSM-5
Die DSM-5-Kriterien für ADHS legen fest, dass eine bestimmte Anzahl an Symptomen über mindestens sechs Monate hinweg bestehen muss, in einem dem Entwicklungsstand unangemessenen Ausmaß. Diese Symptome werden in die Bereiche Unaufmerksamkeit sowie Hyperaktivität und Impulsivität unterteilt. Zusätzlich müssen die Symptome früh beginnen, in mehreren Lebensbereichen auftreten und zu deutlichen Beeinträchtigungen führen.
Während nach ICD-10 sowohl Aufmerksamkeitsdefizit als auch Hyperaktivität und Impulsivität vorliegen müssen, sehen die DSM-5-Kriterein dagegen drei Erscheinungsbilder vor:
- kombiniertes Erscheinungsbild (früher: Mischtyp), bei dem sowohl Aufmerksamkeitsdefizit als auch Hyperaktivität und Impulsivität vorhanden sind
- vorwiegend unaufmerksames Erscheinungsbild, bei dem Hyperaktivität und Impulsivität nicht bzw. nicht augenfällig ausgeprägt sind
- vorwiegend hyperaktiv-impulsives Erscheinungsbild, bei dem das Aufmerksamkeitsdefizit nicht bzw. nicht stark ausgeprägt ist
Der vorwiegend unaufmerksame Subtyp wird in der Prävalenzschätzung häufig unterrepräsentiert, da aufgrund der meist subtilen Symptomatik seltener eine ärztliche Vorstellung erfolgt und die diagnostische Erfassung entsprechend erschwert ist.
DSM-5 erhöhte 2013 das Alterskriterium für den Symptombeginn von vormals 7 auf 12 Jahre und reduzierte ab dem 17. Lebensjahr die erforderliche Symptomanzahl von 6 auf 5.
| Kriterium | Beschreibung und Symptome |
|---|---|
| A. Zentrale Symptomkategorien | ≥ 6 Symptome (ab 17 Jahren ≥ 5) aus einer oder beiden der folgenden Kategorien müssen während der letzten 6 Monate beständig in einem dem Entwicklungsstand des Kindes unangemessenen Ausmaß vorhanden gewesen sein
Unaufmerksamkeit:
Hyperaktivität und Impulsivität:
|
| B. Früher Beginn | Einige Symptome der Hyperaktivität, Impulsivität oder Unaufmerksamkeit, die Beeinträchtigungen verursachen, treten bereits vor dem Alter von zwölf Jahren auf. |
| C. Auftreten in mehreren Lebensbereichen | Die Beeinträchtigungen durch diese Symptome zeigen sich in zwei oder mehr Bereichen (z.B. in der Schule, am Arbeitsplatz oder zu Hause). |
| D. Klinisch bedeutsame Beeinträchtigung | Es müssen deutliche Hinweise auf klinisch bedeutsame Beeinträchtigungen der sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsfähigkeit vorliegen. |
| E. Ausschluss anderer Störungen | Die Symptome treten nicht ausschließlich im Verlauf einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung, Schizophrenie oder einer anderen psychotischen Störung auf und können auch nicht besser durch eine andere psychische Störung erklärt werden (z. B. affektive Störung, Angststörung, dissoziative Störung oder Persönlichkeitsstörung). |
... im Erwachsenenalter
Die Diagnostik von ADHS im Erwachsenenalter unterscheidet sich in mehreren Punkten von der bei Kindern. Symptome treten oft weniger deutlich hyperaktiv, dafür stärker als innere Unruhe, Desorganisation, Vergesslichkeit oder Impulsivität auf. Häufig bestehen kompensatorische Strategien, welche die Störung zeitweise überdecken können.
Für die Diagnose gilt weiterhin, dass Symptome bereits seit der Kindheit vorhanden gewesen sein müssen (rückblickende Anamnese) und in mehreren Lebensbereichen zu deutlichen funktionellen Beeinträchtigungen führen. Die Beurteilung sollte multimodal erfolgen, d.h. unter Einbeziehung von Selbstberichten, Fremdanamnesen und standardisierten Fragebögen.
Besonderes Augenmerk liegt auf der Differenzialdiagnostik, da ähnliche Symptome auch bei affektiven, Angst- oder Persönlichkeitsstörungen sowie bei Substanzgebrauch oder neurodegenerativen Erkrankungen vorkommen können. Eine erstmalige Symptommanifestation im höheren Alter erfordert daher besondere diagnostische Vorsicht.
Therapie
Die ADHS verlangt leitliniengerecht je nach Ausprägung ein multimodales Behandlungskonzept. Es umfasst neben psychologischen, edukativen und sozialen Maßnahmen oft auch eine medikamentöse Therapie.
Oft ist die Medikation eine notwendige Unterstützung der Psychotherapie bzw. der Erziehungsberatung und Pädagogik, da so die vermittelten Anweisungen und Massnahmen besser verinnerlicht werden können.
Medikamentöse Therapie
Die aktuelle Leitlinie empfiehlt eine medikamentöse Behandlung ab einer moderaten bis mittelschweren Symptomatik bei Kindern und Jugendlichen. Bei Erwachsenen zählt die medikamentöse Therapie zur Erstlinientherapie. In beiden Fällen wird Methylphenidat eingesetzt und die Dosis an die Erfordernisse des Einzelfalls angepasst. Die Therapie mit Methylphenidat sollte mit einer niedrigen nicht-retardierten Dosis begonnen und in kleinen Stufen bis zum Erreichen einer verträglichen und genügend wirksamen Dosis gesteigert werden.
Hierbei gilt der Grundsatz, die Dosis so klein wie möglich zu halten, ohne dabei zu niedrig zu dosieren. Die Behandlung sollte einschleichend begonnen werden. Es empfiehlt sich ein Beginn mit 5 mg und Einnahmeintervallen von 3,5–4 Stunden. Als praktikabel hat sich folgendes Schema bewährt (Angaben in mg):
- 1.–3. Tag: 5-0-0
- 4.–6. Tag: 5-5-0
- 7.–9. Tag: 5-5-5
- ab 10. Tag: 10-5-5
Anschließend kann die Tagesdosis in ein- bis zweiwöchentlichen Abständen die Tagesdosis um 5–10 mg erhöht werden, wobei eine maximale Tagesdosis von 60 mg nicht überschritten werden sollte.
Die Gesamttagesdosis wird üblicherweise über den Tag verteilt eingenommen. Nach erfolgter Einstellung wird überprüft, ob die Patienten-Compliance gut ist. Vor allem im Schulkindalter wird die zweite Dosis, deren Einnahme in die Schulzeit fällt, häufig vergessen. In diesem Fällen kann sich ein lang- oder mittellang wirkendes Retardpräparat anbieten.
Psychotherapie
Verhaltenstherapien und Elterntraining sind insbesondere bei Betroffenen im Kindesalter essentiell.
Verhaltenstherapie umfasst die systematische Anwendung von Prinzipien der Verhaltensmodifikation, wie positive Verstärkung, konsequente Reaktion auf problematisches Verhalten und gezielte Förderung sozialer Kompetenzen.
Elterntraining (Parent Training in Behavior Management, PTBM) vermittelt den Eltern Techniken zur Strukturierung des Alltags, zur Verbesserung der Eltern-Kind-Interaktion, sowie zur Anwendung von Belohnungssystemen.
Bei Jugendlichen und Erwachsenen mit ADHS wird häufig eine kognitive Verhaltenstherapie (CBT) empfohlen. Diese umfasst Ansätze, die Verhaltenstherapie mit kognitiven und organisatorischen Trainings kombinieren. Damit können positive Effekte auf Alltagsbewältigung, akademische Leistungen und soziale Integration erzielt werden. CBT adressiert zusätzlich komorbide Symptome wie Ängste oder Depressionen.
Neurofeedbacktherapie
Als weitere nicht-medikementöse Therapie kann eine Neurofeedbacktherapie angewandt werden, deren Wirksamkeit bei ADHS jedoch laut aktueller Evidenzlage begrenzt und umstritten ist.
Dabei sollen symptombedingende Anomalie im Bereich der Gehirnfrequenzverteilung durch EEG-unterstütztes Training normalisiert werden. Verbesserungen der Verarbeitungsgeschwindigkeit oder des Arbeitsgedächtnisses können sich nach ca. 10–20 Sitzungen einstellen. Als Therapiedauer werden rund 40 Stunden empfohlen. Die Ergebnisse sollen aufgrund der Neuroplastizität permanent sein und in geeigneten Fällen eine weitere Behandlung mit Psychopharmaka überflüssig machen.
Kontroverse
Sowohl die Diagnose als auch die medikamentöse und nicht-medikamentöse Behandlung der ADHS sind umstritten und werden – auch innerhalb der medizinischen Fachkreise – kontrovers diskutiert. Einige Kritiker halten ADHS nicht für ein eigenständiges Krankheitsbild, sondern für eine unscharfe Sammelbezeichnung ganz unterschiedlicher Verhaltensstörungen. Insbesondere die Diagnosekriterien für ADHS werden in Frage gestellt, da sie einer gesellschaftlichen Wertung unterliegen und damit soziale Erwünschtheit und Verhaltensnormierung implizieren.[8]
Ärztliche und nicht-ärztliche Kritiker warnen davor, dass die Pharmakotherapie häufig ohne ausreichende Diagnose verordnet wird und dazu eingesetzt werden könnte, anders geartete Probleme – insbesondere Störungen des familiären Umfelds – zu kaschieren. Auch wird befürchtet, dass mit dem Begriff unter Umständen normale kindliche Verhaltensmuster unnötig pathologisiert werden.[9]
Literatur
- American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Practice parameters for the assessment and treatment of children, adolescents and adults with attention‑deficit / hyperactivity disorder, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 1997
- American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Practice parameter for the use of stimulant medications in the treatment of children, adolescents, and adults, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2002
- American Academy of Pediatrics, Clinical Practice Guideline: Treatment of the school‑aged child with attention‑deficit/hyperactivity disorder, Pediatrics, 2001
- American Academy of Pediatrics, Clinical practice guideline: Diagnosis and evaluation of the child with attention‑deficit/hyperactivity disorder, Pediatrics, 2000
- Deutsche Gesellschaft für Kinder‑ und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Berufsverband der Ärzte für Kinder‑ und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Deutschland, Bundesarbeitsgemeinschaft der leitenden Klinikärzte für Kinder‑ und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Leitlinien zur Diagnostik und Therapie von psychischen Störungen im Säuglings‑, Kindes‑ und Jugendalter. Köln: Deutscher Ärzte Verlag, 2000
- Döpfner et al., Hyperkinetische Störungen. In: Leitfaden Kinder‑ und Jugendpsychotherapie, Band 1. Göttingen: Hogrefe, 2000
- Döpfner und Lehmkuhl, ADHS von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter – Einführung in den Themenschwerpunkt, Kindheit und Entwicklung, 2002
- Döpfner und Lehmkuhl, Hyperkinetische Störungen, Leitlinien zur Diagnostik und Therapie von psychischen Störungen im Säuglings‑, Kindes‑ und Jugendalter, 2. überarb. Aufl., Deutscher Ärzte Verlag, 2003
- Döpfner et al., Diagnostik psychischer Störungen im Kindes‑ und Jugendalter. Leitfaden Kinder‑ und Jugendpsychotherapie, Band 2, Göttingen: Hogrefe, 2000
- Ebert et al., ADHS im Erwachsenenalter – Leitlinien auf der Basis eines Expertenkonsensus mit Unterstützung der DGPPN. Der Nervenarzt, 2003
- Taylor et al., Clinical guidelines for hyperkinetic disorder, European Child & Adolescent Psychiatry, 1998
- Bundesärztekammer, Stellungnahme zur „Aufmerksamkeitsdefizit‑/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)” (Langfassung)
- Zhou et al., Network Meta-Analysis of the Effects of Long-Term Non-Pharmacologic Treatment on Inhibitory Control in Children and Adolescents With Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Journal of Psychiatric Research, 2025
Weblinks
Selbsthilfegruppen und Portale
Quellen
- ↑ 1,0 1,1 Faraone et al., The age-dependent decline of attention deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis of follow-up studies, Psychol Med, 2006
- ↑ Faraone et al., Faraone und Larsson, Genetics of attention deficit hyperactivity disorder, Mol Psychiatry, 2019
- ↑ Leffa et al., The synergistic effect of genetic and environmental factors on ADHD development, Transl Psychiatry, 2023
- ↑ Thorsheim et al., Maternal exacerbating and protective factors that shape the prevalence and severity of child attention-deficit hyperactivity disorder: a narrative review, Front Psychiatry, 2025
- ↑ Uchida et al., The Heritability of ADHD in Children of ADHD Parents: A Post-hoc Analysis of Longitudinal Data, J Atten Disord, 2023
- ↑ Koutsoklenis und Honkasilta, ADHD in the DSM-5-TR: What has changed and what has not, Front Psychiatry, 2023
- ↑ https://www.icd-code.de/icd/code/F90.-.html ICD-Code F90.- Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung], abgerufen am 07.10.2025
- ↑ Hirth N. ADHS als soziales Krankheitsbild? Eine kritische Betrachtungsweise der Medikalisierung von abweichendem sozialem Verhalten in modernen westlichen Gesellschaften. ExMA-Papers ISSN 1868-5005/45 Zentrum für Ökonomische und Soziologische Studien 2021
- ↑ Coghill et al., The management of ADHD in children and adolescents: bringing evidence to the clinic: perspective from the European ADHD Guidelines Group (EAGG), Eur Child Adolesc Psychiatry, 2023