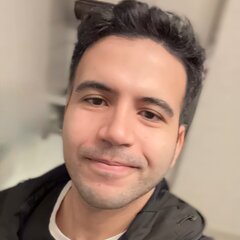Influenza-B-Virus
Englisch: Influenza-B-virus
Definition
Das Influenza-B-Virus ist ein RNA-Virus aus der Familie der Orthomyxoviren und gehört zu den Erregern der Influenza. Es ist bislang ausschließlich beim Menschen und in Seehunden nachgewiesen worden, im Gegensatz zum Influenza-A-Virus, das ein breiteres Wirtsspektrum hat.
Einteilung
Das Influenza-B-Virus wird im Gegensatz zum Influenza-A-Virus nicht in weitere Subtypen eingeteilt. Allerdings wird anhand der Oberflächenproteine zwischen der Victoria-Linie und Yamagata-Linie unterschieden, wobei die letztere seit 2020 nicht mehr nachgewiesen wurde.
Genom
Übertragung
Die Übertragung erfolgt primär durch Tröpfcheninfektion (z.B. beim Husten oder Niesen) sowie durch Schmierinfektion (z.B. kontaminierte Oberflächen) mit einer Inkubationszeit von 1 bis 2 Tagen.
Diagnostik
Zum Nachweis einer Infektion mit dem Influenza-B-Virus werden vorrangig die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und der Antigennachweis mittels ELISA eingesetzt. Aufgrund ihrer hohen Sensitivität und Spezifität gilt die PCR als Goldstandard. Der ELISA-basierte Antigennachweis besitzt hingegen zwar eine hohe Spezifität, weist jedoch lediglich eine mäßige Sensitivität auf.
Die Virusanzucht mittels Kulturen ist nur für die Forschung relevant, aber für die Routinediagnostik zu aufwändig.
Klinik
Klinisch lässt sich eine Infektion mit dem Influenza-B-Virus nicht von einer Infektion mit dem Influenza-A-Virus unterscheiden, jedoch weist sie meist mildere Krankheitsverläufe auf. Kennzeichnend ist ein plötzlicher Krankheitsausbruch mit typischen Symptomen wie:
- hohes Fieber
- trockener Husten
- Halsschmerzen
- Gliederschmerzen
Ältere Menschen, Schwangere und Patienten mit chronischen Erkrankungen oder Immundefizienz haben ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe und Komplikationen wie Pneumonie oder sekundäre bakterielle Superinfektionen.
siehe Hauptartikel: Influenza
Therapie
Die Therapie ist in der Regel rein symptomatisch. Bei schweren Verläufen oder Risikopatienten kommen wie bei Influenza-A-Infektionen in erster Linie Neuraminidasehemmer zum Einsatz. Sie binden selektiv an das aktive Zentrum der viralen Neuraminidase und verhindern so die Freisetzung neugebildeter Viruspartikel aus infizierten Zellen. Es stehen Oseltamivir (oral), Zanamivir (inhalativ, i.m., i.v.) und Peramivir (i.m., i.v.) zur Verfügung. Die Neuramidasehemmer können prophylaktisch oder therapeutisch eingesetzt werden, wobei die Einnahme in letzterem Fall 48 Stunden nach Auftreten der Symptome begonnen werden sollte.
Weiterhin steht noch der Endonuklease-Inhibitor Baloxavirmarboxil zur Verfügung. Er hemmt den Replikationsprozess des Virus.
Impfung
Die jährliche Influenza-Impfung ist derzeit quadrivalent und deckt sowohl die Yamagata- als auch die Victoria-Linie des Influenza-B-Virus ab. Aktuell (Stand 2025) wird jedoch diskutiert, ob die Yamagata-Linie aufgrund ihrer Auslöschung künftig nicht mehr mitgeführt werden soll.
Quellen
- Influenza (Teil 1): Erkrankungen durch saisonale Influenzaviren, abgerufen am 07.03.2024
- Empfehlungen zur Impfstoffkomposition für die nördliche Hemisphäre in der Influenzasaison 2025/26, abgerufen am 07.03.2024
Literatur
- Herdegen, Kurzlehrbuch Pharmakologie und Toxikologie, 5., überarbeitete Auflage, Thieme, 2024