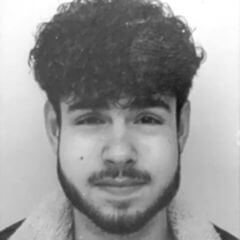Pallidum
von lateinisch: globus - Kugel und pallidus - blass
Synonym: Globus pallidus
Englisch: pallidum
Definition
Das Pallidum ist ein Kerngebiet im Telencephalon, das funktionell den Basalganglien zugeordnet wird.
Embryologie
Zu Beginn des 3. Entwicklungsmonats wird durch Einwachsen von Projektionsbahnen (Capsula interna) das Pallidum vom Thalamus ventralis abgegliedert. Damit gelangt es an das Putamen und somit in das Telencephalon. Entsprechend ist das Pallidum entwicklungsgeschichtlich dem Diencephalon zuzurechnen.
Anatomie
Die Kerngruppen des Pallidums zählen zusammen mit denen des Striatums (Nucleus caudatus, Putamen, Striatum ventrale) zu den Nuclei basales im engeren Sinne.
Putamen und Globus pallidus sind durch die Lamina medullaris externa (lateralis) getrennt, bilden jedoch insgesamt einen Kernkomplex, der als Nucleus lentiformis bezeichnet wird.
Das Pallidum wird wegen seiner im Vergleich zu Putamen und Nucleus caudatus helleren Färbung auch "blasser Kern" genannt. Nach medial läuft er konisch zu und wird von der Capsula interna begrenzt. Seine mediale Spitze liegt dabei im Knie der Capsula.
Im Pallidum finden sich große, multipolare, GABAerge Neurone mit hoher elektrischer Spontanaktivität. Die ventralen Anteile des Globus pallidus werden zusammen mit Zellgruppen in der Substantia innominata (Pars subcommissuralis) als Pallidum ventrale zusammengefasst. Die dorsalen Hauptanteile des Globus pallidus werden als Pallidum dorsale bezeichnet. Beide gehen ohne klare Grenze ineinander über.
Durch die Lamina medullaris interna (medialis) ist der Globus pallidus in einen Globus pallidus externus (lateralis) und Globus pallidus internus (medialis) unterteilt. In der Pars subcommissuralis des ventralen Pallidums lassen sich die zwei funktionellen Bereiche durch neurochemische Untersuchungen differenzieren.
Nach histologischen und funktionellen Gesichtspunkten gehört die Pars reticularis der Substantia nigra im Mesencephalon ebenfalls zum Pallidum mediale. Man spricht hier auch vom Pallidum-mediale-Komplex.
Afferenzen
Die Neurone des Pallidums erhalten hemmende Afferenzen aus dem Striatum. Außerdem wird ihre Aktivität durch dopaminerge Afferenzen aus der Pars compacta der Substantia nigra sowie durch glutamaterge Innervation aus dem Nucleus subthalamicus und dem Nucleus tegmentalis pedunculopontinus moduliert.
Efferenzen
Hemmende Efferenzen des Pallidum laterale ziehen zum Nucleus subthalamicus. Dieser projiziert anschließend zum Pallidum-mediale-Komplex (s.u.). Außerdem innerviert das Pallidum laterale direkt das Pallidum mediale, die Pars reticularis der Substantia nigra und den Nucleus reticularis. Projektionen erreichen auch Interneurone im Striatum.
Hemmende Efferenzen des Pallidum-mediale-Komplexes innervieren verschiedene Thalamuskerne (Nucleus ventralis anterior, Nucleus ventralis lateralis, Nucleus mediodorsalis), die bestimmte Kortexareale erreichen. Außerdem werden über Projektionen in Nuclei intralaminares und Nuclei mediani Nebenschleifen gebildet. Weitere Efferenzen erreichen den Nucleus habenularis lateralis und den Nucleus tegmentalis pedunculopontinus.
Die Pars reticularis der Substantia nigra entsendet auch Efferenzen zum Colliculus superior und gilt daher als okulomotorisches Zentrum des Pallidum-mediale-Komplexes.
Funktion
Die dorsalen Anteile des Pallidums (und des Striatums) sind insbesondere mit der Kontrolle der Somatomotorik befasst. Die kleineren, ventralen Anteile der Nuclei basales gehören zur Pars basalis telencephali. Sie stehen in enger Beziehung zum limbischen System und scheinen für motivationsabhängiges, emotionales Verhalten eine wichtige Rolle zu spielen.
Im Rahmen der Basalganglienschleife erfolgt ein Informationsfluss vom Kortex in die Basalganglien, von dort in den Thalamus und wieder zurück zum Kortex. Dabei bildet das Striatum die Haupteingangsstation in das Basalgangliensystem, während der Pallidum-mediale-Komplex die Hauptausgangsstation darstellt. Die inhibitorischen Neurone des Pallidum-mediale-Komplex zeigen eine tonische Aktivität. Unbeeinflusst hemmen die Basalganglien daher die thalamokortikale Erregungsübertragung. Prozesse in den Basalganglien selbst modulieren dabei die Aktivität des Pallidum-mediale-Komplexes.
Kortikale Afferenzen zum Striatum sind glutamaterg und erregen die inhibitorischen Neurone des Striatums. Die weitere Informationsverarbeitung erfolgt dann auf zwei Wegen:
- Direkter Weg: Neurone des Striatums hemmen die Neurone des Pallidum-mediale-Komplexes. Dadurch kommt es zu einer phasischen Disinhibition thalamischer Neurone, die frontale kortikale Neurone aktivieren können.
- Indirekter Weg: Das Striatum hemmt das Pallidum laterale. Dessen inhibitorische Efferenzen ziehen zum Nucleus subthalamicus. Insgesamt führt die Erregung des Striatums zu einer Disinhibition des Nucleus subthalamicus. Seine Neurone erregen den Pallidum-mediale-Komplex. Der indirekte Weg sorgt somit für eine Verstärkung der Inhibition des Thalamus.
Nach dieser Modellvorstellung soll der direkte Weg "erwünschte" Bewegungen fördern, während die Aktivität des indirekten Weges "unerwünschte" Programme hemmt. Einige klinische und experimentelle Befunde lassen sich aber derzeit (2023) nicht durch das Modell erklären.