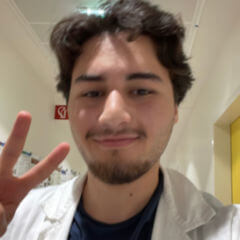Phimose
Synonym: Vorhautverengung
Englisch: phimosis
Definition
Eine Phimose liegt vor, wenn das Präputium (die Vorhaut) nicht über die Glans penis zurückgeschoben werden kann.
- ICD-10: N47 (Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose)
Einteilung
Man unterscheidet die normale, physiologische Phimose und pathologische Phimosen. Eine nicht zurückziehbare Vorhaut im Kindes- und Jugendalter ist bis zum Ende der Pubertät normal und bedarf keiner Therapie.[1] Persistiert die Phimose, oder macht sie sich durch Nebensymptome bemerkbar ist, muss sie behandelt werden.
Eine Phimose kann auch im späteren Alter durch nachlassende Hautelastizität oder durch Narben von Verletzungen oder Entzündungen neu auftreten (erworbene oder sekundäre Phimose).
Physiologische Phimose
Bei der Geburt ist die Vorhaut mit der Eichel verklebt, um die empfindliche Eichel vor schädlichen Umwelteinflüssen zu schützen. Mit der Zeit löst sich diese natürliche Verklebung auf, sodass sich die Vorhaut zurückstreifen lässt. Dieser Ablösungsprozess findet in einem individuell verschiedenen Zeitraum statt. Manchmal dauert es bis zum Abschluss der Pubertät, bis sich die Vorhaut von der Eichel gelöst hat.[1][2]
Manche Autoren bevorzugen den Begriff "Präputialverklebung", da der Begriff "Phimose" fälschlicherweise einen Krankheitswert impliziert.
Pathologische Phimose
Von einer pathologischen Phimose spricht man, wenn Nebensymptome auftreten. Dazu zählen zum Beispiel
- ohne jegliche äußere Ursache auftretende, rezidivierende Entzündungen der Eichel und/oder der Vorhaut (Entzündungen an den Genitalien haben oft äußere Ursachen, wie die Verwendung von stark alkalischen Seifen beim Waschen, das vorzeitige Zurückstreifen der Vorhaut durch Ärzte oder Eltern oder Chemikalien, wie sie etwa im chlorierten Wasser von Schwimmbädern enthalten sind.
- nachhaltiger Harnstau (Ein Harnstau ist nicht äußerlich sichtbar, er kann nur mittels bildgebender Verfahren diagnostiziert werden. Ein bloßes ballonartiges Aufblähen der Vorhaut jedoch, das sogenannte "Ballonieren der Vorhaut“ , ist meist normal und weist nicht zwangsläufig auf einen nachhaltigen Harnstauung hin).[3]
- ein weißlicher Ring von hartem Narbengewebe, der sich an der Spitze der Vorhaut bildet, die sogenannte Narbenphimose (Die Narbenphimose ist eine Form des Lichen sclerosus et atrophicus, veraltet auch Balanitis xerotica obliterans (BXO) genannt, einer chronisch-entzündlichen Hautkrankheit bislang noch ungeklärten Ursprungs. Der weißliche unelastische Ring erschwert das Zurückziehen der Vorhaut.)[4]
Bedenken, dass bei Phimose nicht oder nur schwer entfernbare Smegma könnte zu einem erhöhten Risiko für Penis- oder Zervixkarzinome beitragen, gelten als widerlegt. Smegma ist keine karzinogene Substanz. Eine Zirkumzision als Prophylaxe gegen Penis- oder Zervixkarzinom ist keine sinnvolle Behandlungsoption.
Epidemiologie
Nur 44 % der zehnjährigen, 60 % der zwölfjährigen, 85 % der vierzehnjährigen und 95 % der siebzehnjährigen Jungen haben eine vollständig zurückziehbare Vorhaut.[1]
| Alter in Jahren | Vorhaut zurückziehbar |
|---|---|
| 6-7 | 23% |
| 8-9 | 34% |
| 10-11 | 44% |
| 12-13 | 60% |
| 14-15 | 85% |
| 16-17 | 95% |
Diagnose
Die Diagnose wird in der Regel klinisch gestellt. Das Präputium lässt sich bei einer Phimose nicht oder nur teilweise über die Glans zurückziehen. Die interindividuellen Entwicklungsunterschiede (s.o.) sind dabei zu berücksichtigen.
In Zweifelsfällen sollte ein entsprechend geschulter Facharzt hinzugezogen werden, da oft Fehldiagnosen gestellt werden. So konnten bei einer Überprüfung einer Anzahl von Phimose-Diagnosen durch einen pädiatrischen Urologen in England nur 15 % der Diagnosen durch Hausärzte und 12 % der Diagnosen durch Kinderärzte bestätigt werden.[5]
Therapie
Bei einer symptomfreien Vorhautverengung – der physiologischen Phimose – kann mit der Behandlung bis zur Vollendung der Pubertät zugewartet werden.
Nur pathologische Phimosen müssen behandelt werden. Dafür stehen zwei Hauptverfahren zur Verfügung:
- konservative Behandlungen (die sowohl nicht-operative und operative Behandlung beinhalten) und
- invasive operative Behandlungen
Eine konservative, nicht operative Behandlung ist einer operativen immer vorzuziehen. Eine operative Behandlung sollte erst angedacht werden, wenn konservative Therapieversuche gescheitert sind.[6][7][8][9]
Forschungsergebnisse der letzten Jahre machen deutlich, dass konservative (nichtoperative) Maßnahmen kostengünstig und effektiv sind.[9][10][7][8]
Konservative Behandlung
Die nichtoperative Behandlung umfasst die Dehnung der Phimose oder das Lösen der Verklebung durch vorsichtiges Verschieben der Vorhaut, soweit dies schmerzfrei und ohne Widerstand möglich ist. Dabei werden glukokortikoidhaltige Salben aufgetragen. Diese Maßnahme wird über einen längeren Zeitraum durchgeführt und hat bei sachgerechter Durchführung keine Nebenwirkungen.[9] Die Erfolgsrate bei der konservativen Behandlung von Phimosen mit Salbenpräparaten liegt nach den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Urologie zwischen 50 % bis 75 %, gemäß neuerer medizinischer Studien sogar noch höher.[7][8]
Topische Glukokortikoide (z.B. Betamethason) sind die Behandlungsmethode der Wahl für Phimosen aufgrund ihrer geringeren Morbidität, Abwesenheit von Schmerz und Trauma und geringer Kosten.[11]
Operative Behandlung
Präputiumsplastik
Eine Präputiumplastik oder Vorhautplastik bezeichnet eine Operationsmethode, bei der die Vorhaut vollständig erhalten bleibt. Hierbei werden ein kosmetisch gutes Operationsergebnis und eine vollständige Erhaltung der Vorhaut erreicht. Dabei unterscheidet man zwischen unterschiedlichen Operationsverfahren. Das Grundprinzip vieler Vorhautplastiken besteht in einem oder mehreren kleinen Längsschnitten und der anschließenden Quervernähung der Wunddefekte.
- Dorsalschnitt mit transversalen Verschlüssen: Bei dieser Operationstechnik erfolgt eine kleine Inzision längs durch den stenotischen Ring, welche anschließend quervernäht (transversal verschlossen) wird.[12][13]
- Laterale Präputiumsplastik: Die laterale Präputiumsplastik stellt eine kleine Verfeinerung des Dorsalschnitts mit transversalem Verschluss da. Hierbei werden zwei kleine laterale Längsschnitte ausgeführt und anschließend quervernäht.
- Triple-Inzision: drei kleine Längsschnitte in die Vorhaut, welche auf die erforderliche Weite gedehnt und wieder vernäht werden.[14][15]
Präputiumplastiken haben eindeutige Vorteile gegenüber der Zirkumzision. Wenn bei einer pathologischen Phimose nach einer erfolglosen Dehnungstherapie mit topischen Glukokortikoiden ein operativer Eingriff unumgänglich wird, ist eine Präputiumplastik aufgrund der geringeren Morbidität, der geringeren Komplikationsrate und der niedrigeren Kosten einer klassischen Zirkumzision immer vorzuziehen.[13][12]
Zirkumzision
Bei der Zirkumzision wird die Vorhaut, auf Wunsch des Patienten bzw. auf Wunsch der Eltern, entweder ganz (radikale Zirkumzision) oder aber nur der vordere verengte Teil der Vorhaut (partielle Zirkumzision) entfernt. Bei der partiellen Zirkumzision hängt die wirkliche Größe des zirkumzidierten Vorhautteils letztendlich von der Präferenz des Operateurs ab. Darüber hinaus wächst die Vorhaut langsamer als der Rest des Penis, so dass das endgültige optische Resultat später unter Umständen kaum von einer radikalen Zirkumzision zu unterscheiden ist.
Die Zirkumzision hat eine hohe Morbiditätsrate einschließlich Blutungen, Ulzerationen und Meatusstenosen.[16] Keiner dieser Komplikationen tritt bei einer Präputiumplastik auf, die ein weit weniger schwerwiegender Eingriff ist.[17]
Die Zirkumzision ist nur als ultima ratio bei besonders schweren Fällen von pathologischer Phimose indiziert, bei denen sowohl die nicht-operative Therapie mit Glukokortikoiden als auch eine Vorhaut-erhaltende Präputiumplastik keinen Heilungserfolg brachten.
Es ist zu beachten, dass die invasive operative Behandlung der Phimose, die Beschneidung, ein Risiko für Komplikationen (2% bis 10% [16]) und Operationstraumata birgt. Behandlungen im Genitalbereich können bei Angehörigen beiderlei Geschlechts zu einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS bzw. PTSD) führen. Entscheidende Faktoren für die Ausprägung einer PTBS sind u.a: Gefühle der Machtlosigkeit und des Kontrollverlusts, fehlende Zustimmung, fehlende Information darüber, was während der Untersuchung geschehen soll, fehlendes Einfühlungsvermögen durch den behandelnden Arzt und die Erfahrung von physischem Schmerz.[18] Die Vermutung, dass ein Zusammenhang zwischen Beschneidung und dem Auftreten einer PTBS besteht, wird durch eine in Boyle et al. (2002) beschriebene Studie[19] erhärtet.[20] In der besagten Studie wurden 1.577 philippinische Jungen im Alter von 11 bis 16 Jahren vor und nach einer Beschneidung (die entweder mit oder ohne Lokalanästhetikum durchgeführt wurde) beobachtet. Vor dem Eingriff wurde sichergestellt, dass nur Jungen in die Studie aufgenommen wurden, die keine PTBS (nach DSM-IV) aufwiesen. Nach dem Eingriff konnte bei 50% der mit Lokalanästhetikum und 69% der rituell (ohne Lokalanästhetikum) beschnittenen Jungen eine PTBS nach DSM-IV Kriterien diagnostiziert werden.[19]
Podcast

Quellen
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Oster J(1968)."Further fate of the foreskin. Incidence of preputial adhesions, phimosis, and smegma among Danish schoolboys". Arch Dis Child43(228): 200–3. doi:10.1136/adc.43.228.200. PMID 5689532.
- ↑ Kabaya H; Hiromi T, Seiichi K, Yoshiyuki F, Tetsuo K, Tetsuro K(November 1996)."Analysis of shape and retractability of the prepuce in 603 Japanese boys". Journal of urology156(5): 1813–1815. doi:10.1016/S0022-5347(01)65544-7. PMID 8863623.
- ↑ Babu R, Harrison SK, Hutton KA(2004)."Ballooning of the foreskin and physiological phimosis: is there any objective evidence of obstructed voiding?". BJU Int.94(3): 384–7. doi:10.1111/j.1464-410X.2004.04935.x. PMID 15291873.
- ↑ Laymon CW, Freeman C(1944)."Relationship of Balanitis Xerotica Obliterans to Lichen Sclerosus et Atrophicus". Arch Dermat Syph49: 57–9.
- ↑ McGregor et al, Can J Urol. 2005, Phimosis--a diagnostic dilemma? Pubmed
- ↑ James E. Ashfield, Kyle Nickel, D. Robert Siemes, Adrew E. McCneily, J. Curtis Nickel: Treatment of phimosis with topical steroids in 194 children. In: Journal of Urology. Jg. 169, Nr.3, 2003, S. 1106-1108.
- ↑ 7,0 7,1 7,2 MedReview, Ausgabe 12/2004, Seite 10
- ↑ 8,0 8,1 8,2 Yilmaz E. Batislam E, Basar MM, Basar H.(2003)."Psychological trauma of circumcision in the phallic period could be avoided by using topical steroids". Int J Urol10(12): 651-6.
- ↑ 9,0 9,1 9,2 Esposito C, Centonze A, Alicchio F, Savanelli A, Settimi A(April 2008)."Topical steroid application versus circumcision in pediatric patients with phimosis: a prospective randomized placebo controlled clinical trial". World J Urol26(2): 187–90. doi:10.1007/s00345-007-0231-2. PMID 18157674. Referenzfehler: Ungültiges
<ref>-Tag. Der Name „World Journal of Urology“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. - ↑ Phimosis and topical steroids: new clinical findings, Pediatric Surgery International, Ausgabe 2007, Band 23, S.331-335
- ↑ Berdeu D, Sauze L, Ha-Vinh P, Blum-Boisgard C(2001)."Cost-effectiveness analysis of treatments for phimosis: a comparison of surgical and medicinal approaches and their economic effect". BJU Int.87(3): 239–244. PMID 11167650.
- ↑ 12,0 12,1 Saxena AK, Schaarschmidt K, Reich A, Willital GH(2000)."Non-retractile foreskin: a single center 13-year experience". Int Surg85(2): 180–3. PMID 11071339.
- ↑ 13,0 13,1 Van Howe RS(1998)."Cost-effective treatment of phimosis". Pediatrics102(4): E43. doi:10.1542/peds.102.4.e43. PMID 9755280.
- ↑ PDF Medical Tribune 11/2000 "Drei Schnitte retten die Vorhaut"
- ↑ C. Fischer-Klein, M. Rauchenwald: Triple incision to treat phimosis in children: an alternative to circumcision?. In: British Journal of Urology International. Nr.92, 2003, S. 459–462.
- ↑ 16,0 16,1 Williams N, Kapila L(1993)."Complications of circumcision". Brit J Surg80(10): 1231–6. doi:10.1002/bjs.1800801005. PMID 8242285.
- ↑ Cuckow PM, Rix G, Mouriquand PD(1994)."Preputial plasty: a good alternative to circumcision". J Pediatr Surg29(4): 561–3. doi:10.1016/0022-3468(94)90092-2. PMID 8014816.
- ↑ Janet Menage: Post-Traumatic Stress Disorder After Genital Medical Procedures. In: G. Denniston: Male and Female Circumcision. Medical, Legal, and Ethical Considerations in Pediatric Practice.
- ↑ 19,0 19,1 S. Ramos & G.J. Boyle: Ritual and Medical Circumcision among Filipino Boys. In: G.C. Denniston, F.M. Hodges & M.F. Milos: Understanding Circumcision. A Multi-Disciplinary Approach to a Multi-Dimensional Problem. 2001
- ↑ Boyle G; Goldman R, Svoboda JS, Fernandez E(2002)."Male Circumcision: Pain, Trauma and Psychosexual Sequelae". Journal of Health Psychology7(3): 329-343.
Weblinks
- Phimose-Info Deutschland. Info- und Beratungsportal zum Thema Phimose und deren Behandlung. Für Betroffene steht ein moderiertes Forum zur Verfügung.
- Fachinformationen und Fachartikel zum Thema Phimose und deren Behandlung
Bildquelle
- Bildquelle Podcast: ©Charles Deluvio / Unsplash