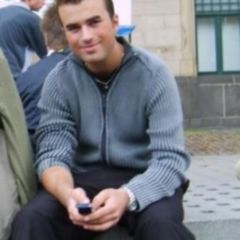Intraaortale Ballonpumpe
Synonym: Intraaortale Ballongegenpulsation
Definition
Die intraaortale Ballonpumpe, kurz IABP, ist ein in der Notfallmedizin eingesetztes Gerät zur Unterstützung der Herzfunktion bei schwerer Herzinsuffizienz, wie sie z.B. als Folge eines Herzinfarktes auftreten kann. Der Einsatz ist angezeigt, wenn andere intensivmedizinische Maßnahmen (z.B. Beatmung, Arzneimittel, etc.) keine ausreichende Stabilisierung bewirken und ein kardiogener Schock droht.
Funktion
Die IABP besteht aus einem Ballonkatheter, der durch die Arteria femoralis in die Aorta descendens (zwischen den Abzweigungen der Nierenarterien und linker Arteria subclavia) eingebracht wird. Weiterer Bestandteil ist eine Maschine, die Helium in den Ballon pumpt und wieder absaugt. Dieser Vorgang wird elektronisch gesteuert und auf Monitore übertragen. Nach Positionierung der IABP ist eine Lagekontrolle mittels Röntgen-Thorax angezeigt.
Wirkungsmechanismus
- In der Füllungsphase (Diastole) des Herzens wird der Ballon aufgeblasen, was als Ballongegenpulsation bezeichnet wird und den diastolischen Blutfluss in die untere Körperhälfte verhindert. Durch die Ballongegenpulsation nimmt die Herzarbeit kompensatorisch ab und es tritt eine bessere Durchblutung der Organe (v.a. von Herz und Gehirn) ein.
- In der Kontraktionsphase (Systole) wird der Ballon aktiv entleert, was zu einer Reduktion des enddiastolischen Aortendrucks führt und den diastolischen Blutfluss in die untere Körperhälfte wieder ermöglicht.
- Insgesamt führt der Einsatz der IABP über eine Nachlastverringerung zu einer geringeren kardialen Belastung und damit zu einer Reduktion des Sauerstoffbedarfes des Herzens. Gleichzeitig wird durch Verbesserung der koronaren Durchblutung das Sauerstoffangebot erhöht.
Die Augmentation findet während der Diastole statt und kann jeweils 1:1, 1:2 oder 1:3 erfolgen
Triggerung
Um Ballonaktivität optimal an den Herzzyklus anzupassen, stehe 2 verschiedene Methoden zur Triggerung zur Verfügung:
- EKG–Triggerung, d.h. die Zeiteinstellung für die diastolische Inflation (= Aufblasen des Ballons) und der präsystolischen Deflation erfolgt über die Berechnung anhand eines EKGs des Patienten. Die R-Zacke des EKGs ist hier das Triggerergebnis.
- Druck-Triggerung, d.h. die Zeiteinstellung erfolgt über die Berechnung das aortalen Druckkurvenverlaufes. Die Triggerung wird in diesem Fall durch den systolischen Druckanstieg ausgelöst.
Indikationen
- kardiogener Schock, welcher nicht durch eine pharmakologische Therapie beherrscht werden kann
- septischer Schock
- akuter Myokardinfarkt
- akute Mitralinsuffizienz oder Ventrikelseptumruptur nach Myokardinfarkt
- schwer beherrschbare ventrikuläre Arrhythmie mit hämodynamischer Instabilität
- Myokardkontusion
- Präoperative Maßnahme vor Herz-OP (bei kardiologischen Risikopatienten)
- Entwöhnungsmaßnahme nach längerem Einsatz einer Herz-Lungen-Maschine
Kontraindikationen
- Aortenaneurysma
- Aortenklappeninsuffizienz
- schwere Arteriosklerose in den betroffenen Blutgefäßen
- Blutungen
- Gerinnungsstörungen