Beckenringfraktur
Englisch: fracture of the pelvic ring
Definition
Unter einer Beckenringfraktur versteht man einen Knochenbruch (Fraktur) im Bereich des Beckens, der die Integrität des Beckengürtels (Cingulum membri inferioris) unterbricht.
Epidemiologie
Beckenringfrakturen sind relativ seltene Frakturen, können jedoch im Alter als einfache Abrissfrakturen häufiger auftreten.
Ätiopathogenese
Beckenringfrakturen werden durch ausgeprägte Gewalteinwirkung auf den Organismus hervorgerufen. Man findet sie gehäuft im Rahmen von Polytraumata, wobei vor allem Stürze aus großer Höhe und Verkehrsunfälle ursächlich sind. In höherem Alter werden sie durch Bagatelltraumen verursacht.
Klinik
Bei der Inspektion lassen sich häufig Hämatome im Perineal- und Inguinalbereich sowie evtl. eine Beckenasymmetrie feststellen. Die betroffenen Patienten geben starke Schmerzen an. Störungen im Bereich von Durchblutung, Motorik und Sensibilität (DMS) sind möglich ebenso wie Blutungen aus dem After, den Urogenitalorganen (Riss der Urethra?) sowie der Haut.
Komplikationen
Aufgrund des Unfallmechanismus treten häufig Begleitverletzungen im Abdominalbereich und im kleinen Becken auf. Es kann zu Verletzungen von Harnblase und Harnröhre sowie Darmperforationen kommen. Weiterhin sind eine Schädigung des Nervus ischiadicus sowie intraperitoneale und retroperitoneale Blutungen durch Verletzung der Iliakalgefäße, dem Plexus venosus sacralis sowie der Arteria femoralis und der Vena femoralis möglich. Aufgrund massiver Blutverluste besteht die Gefahr eines hämorrhagischen Schocks.
Diagnostik
Neben den typischen Symptomen imponiert bei der klinischen Untersuchung ein Kompressions- und Stauchungsschmerz am Becken sowie eine eingeschränkte Bewegung im Hüftgelenk. Eine Beckenübersicht sowie eine Sonographie des Abdomens sollten unbedingt angefertigt werden.
Bei hämodynamisch stabilem Patienten empfehlen sich weiterhin eine Ala-Aufnahme und eine Obturator-Aufnahme des Beckens, ein Röntgen-Thorax, ein Röntgen-Abdomen, ein CT von Abdomen und Becken sowie bei Verdacht auf eine Verletzung der ableitenden Harnwege eine Ausscheidungsurographie.
Klassifikation
Beckenfrakturen werden nach der AO-Klassifikation klassifiziert.
- Typ A: Stabile Beckenringfraktur. Dazu gehören z.B. Frakturen des vorderen Beckenrings, oder Frakturen der Beckenschaufeln, sowie Abrissfrakturen.
- Typ B: Teilweise instabile Beckenringfraktur mit Rotationsinstabilität. Bei dieser Fraktur kann das Becken nach vorne aufgeklappt werden (z.B. Open-Book-Verletzung).
- Typ C: Bei diesem Typ liegt eine komplette Instabilität des Beckenrings vor. Liegt eine Sprengung der Symphyse vor, spricht man von einer Malgaigne-Fraktur.
Therapie
Die Therapie ist abhängig von Begleitverletzungen sowie der Klassifikation.
Typ A
Dieser Frakturtyp wird in der Regel konservativ mit ca. 2 Wochen Bettruhe behandelt.
Typ B/C
Hier ist in der Regel eine operative Therapie (z.B. mit Plattenosteosynthese) erforderlich. Bei schweren und instabilen Frakturen wird eine erste Stabilisierung der Frakturteile durch einen Fixateur externe oder eine Beckenzwinge erreicht.
Podcast
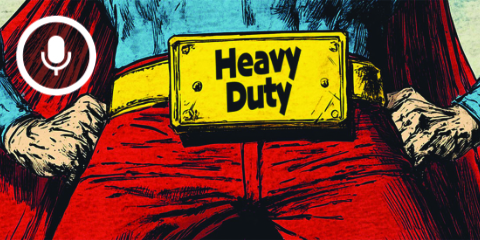
Bildquelle
- Bildquelle Podcast: © Midjourney







