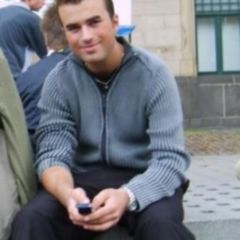Papillärer Tumor der Pinealisregion
Abkürzung: PTPR
Definition
Ein papillärer Tumor der Pinealisregion, kurz PTPR, ist eine sehr seltene Raumforderung des Gehirns, die 2003 das erste Mal beschrieben wurde. Es handelt sich um eine spezielle Form des Pinealoms. Häufig befindet sich der Tumor an der hinteren Begrenzung des 3. Hirnventrikels, was sich klinisch in einer Abflussstörung des Liquor cerebrospinalis äußern kann. Die Folge ist ein erhöhter Hirndruck.
Epidemiologie
Der PTPR tritt praktisch ausschließlich bei Kindern und Jungendlichen auf. Rund 120 Fälle sind seit der Erstbeschreibung bekannt geworden.
Ätiologie
Über die auslösenden Faktoren des PTPR ist bisher noch nicht viel bekannt. Als Ausgangsgewebe werden Ependymzellen des Organum subcommissurale vermutet. Nach derzeitigem Kenntnisstand (2014) liegt keine genetische Ursache zu Grunde.
Pathohistologie
Das Tumorgewebe ähnelt vom Äußeren her einem Epithel und besitzt einen neuroektodermalen Ursprung. Im Vergleich mit zahlreichen anderen Hirntumoren besitzt der PTPR eine relativ niedrige Mitoserate – somit sind unter dem Lichtmikroskop nur wenige Mitosefiguren sichtbar. Die Tumorzellen besitzen kräftig ausgebildete Fortsätze, die meistens in Kontakt mit den Blutgefäßen des Geschwulstes stehen bzw. an diese heranragen. Im Präparat zeigt sich ein hoher Anteil an Nekrosen.
Der PTPR neigt nicht zur Bildung von Metastasen, wächst aber lokal infiltrativ und neigt zu Rezidiven. Laut WHO-Klassifikation der Tumoren des zentralen Nervensystems wird er mit Malignitätsgrad II bis III angegeben.
Lokalisation
Meistens an der Hinterwand des 3. Hirnventrikels in topographischer Nähe zur Zirbeldrüse.
Symptome
Durch die anatomische Lage des Tumors wird die Liquorzirkulation und damit der Abfluss des Liquor cerebrospinalis behindert. Die Folge ist ein erhöhter Hirndruck mit den typischen Symptomen Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen. Kommt es zu einem Kontakt des PTPR mit der Vierhügelplatte, ist die Entstehung eines Parinaud-Syndroms wahrscheinlich. Durch die Nähe zur Zirbeldrüse ist häufig die Melatoninproduktion nicht mehr im Gleichgewicht. Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus sind die Folge.
Diagnose
Die Diagnose erfolgt durch ein kontrastmttelverstärktes MRT. Der PTPR zeigt sich in der Aufnahme deutlich durch eine starke Kontrastmittelanreicherung. Bestätigen lässt sich die Diagnose durch Entnahme einer Biopsie, was aber durch die topographischen Begebenheiten nicht immer möglich ist.
Therapie
Ziel der Behandlung ist immer eine vollständige chirurgische Resektion, die aufgrund der Lokalisation nicht immer möglich ist. Da der PTPR kaum auf Zytostatika anspricht, kommt eine Chemotherapie in der Regel nicht in Frage. Geeigneter ist eine Strahlentherapie, die jedoch häufig auch die Bildung von Rezidiven nicht verhindern kann.