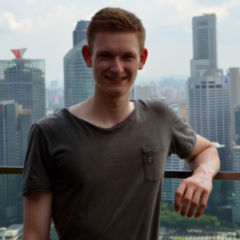Brut (Geflügel)
Englisch: egg incubation
Definition
Als Brut wird die extrauterine Entwicklung des Vogel-Kükens im Ei unter Einwirkung exogener Wärme verstanden. Dabei muss das Milieu (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Luftzusammensetzung) der jeweiligen Entwicklungsstufe entsprechen.
Weg der Bruteier
Sammeln
Bruteier sollten nicht länger als zwei Stunden nach der Eiablage im Nest bzw. Stallmilieu verweilen, um Verschmutzung und Bruch zu mindern. Infolge der Abkühlung des körperwarm gelegten Eies bei 41 °C baut sich im Eiinneren ein negativer Druck auf, der zur Bildung der Luftkammer führt. Gleichzeitig können dadurch Keime über die Schalenporen in das Eiinnere eingesaugt werden oder aktiv eindringen. Im Erzeugerbetrieb erfolgt eine erste Desinfektion, dann findet der Transport zur Brüterei statt.
Sortieren
Die Bruteier werden sortiert nach:
- Form
- Gewicht
- Schalenqualität (nicht zu dünn oder porös, keine Lichtsprünge)
- Lage der Luftkammer am stumpfen Pol
Waschen
Schmutzeier können gegebenenfalls gewaschen werden. Die Waschflüssigkeit soll mindestens 5 °C über der Eiinnentemperatur liegen. Durch das Waschen wird die Lagerfähigkeit jedoch verringert.
Desinfektion
Möglichkeiten zur Entkeimung der Schalenoberfläche:
- Formaldehyd in Gasform
- Flüssige Desinfektionsmittel im Tauch- oder Sprühverfahren
- Kurzzeiterhitzung im Heißluftstrom (80 °C)
- Rassegeflügel oder kleinere Straußenfarmen: Begasung mit Ozon
Erneute Formaldehydbegasungen vor der Bruteieinlage oder während Brut und Schlupf sind ebenso durchführbar.
Lagerung
Die ersten Teilungsvorgänge der Eizelle finden bereits im Eileiter statt. Diese werden nach der Eiablage - abhängig von der Lagerungstemperatur - verlangsamt oder unterbrochen.
Das Einstellen der Bruteier auf eine gleiche Temperatur im Inneren ist eine Voraussetzung für die Schlupfsynchronisation (alle Küken schlüpfen gleichzeitig). Die Lagertemperatur soll 12 °C nicht unterschreiten. Bei 15 °C, 70 % relativer Luftfeuchte und ausreichender Sauerstoffversorgung lassen sich Hühnereier bis zu 14 Tage (Puteneier bis zu 10 Tage, Wassergeflügeleier bis zu 20 Tage) ohne wesentliche Schlupfminderung lagern. Eine Kurzzeitlagerung bis 4 Tage bei Zimmertemperatur (20 bis 25 °C) ist möglich.
Die Eier müssen immer mit dem stumpfen Pol bzw. mit der Luftkammer nach oben gelagert werden, um ein Ankleben des Dotters an die Schaleninnenseite zu vermeiden.
Transport
Der Transport muss möglichst erschütterungsfrei erfolgen. Frische Bruteier sind unempfindlicher, weshalb Transporte über größere Entfernungen mit längerer Zeitdauer nur mit höchstens 5 Tage alten Bruteiern durchgeführt werden. Bei Lufttransporten sind eine Temperatur von 15 °C und eine Sauerstoffversorgung in der Druckkabine einzuhalten.
Behandlung
Zur Eindämmung einer vertikalen Keimübertragung (zum Beispiel Mykoplasmen) wurden in der Vergangenheit Antibiotika eingesetzt. Die Applikation in das Eiinnere kann durch Injektion, Vakuum-Verfahren oder Dipping-Verfahren erfolgen. Die mit dem Dipping-Verfahren verbundene Unterdosierung fördert eine Erregerresistenz und kann bestehende Infektionen verschleiern.
Heute setzen Sanierungsverfahren schon bei den Elterntieren an. Nur Eier von Mykoplasmen- und Salmonellen-freien Elterntiere gelangen in die Brüterei. Kontrollen finden vierzehntägig statt und im Falle positiver Befunde wird die Herde aus der Brütereiproduktion entfernt.
Bruttechnologie
Das Bebrüten eines Eies kann generell als Naturbrut oder Kunstbrut erfolgen.
Naturbrut
Die Naturbrut spielt in der Rassegeflügelzucht, in kleinen Betrieben zur Nachzucht für den Eigenbedarf und bei Straußenvögeln eine Rolle. Nistgelegenheiten entsprechender Größe mit geeignetem Nistmaterial (frische Grassoden, Stroh, Laub) sollten in einem geschützten Raum mit gedämpftem Licht eingerichtet werden. Futter und Tränkwasser müssen in der Nähe zum Nest zur Verfügung stehen.
Kunstbrut
Bei der Kunstbrut werden die Verhältnisse der Naturbrut nachgeahmt. Daher sind Kenntnisse über Physiologie und Anforderungen des Embryos an die Umgebungsbedingungen vom Zeitpunkt des Eisprunges bis zur Eieinlage in den Brutschrank sowie den dortigen Bedingungen notwendig. Zur Kükenproduktion werden Schrankbrüter oder Raumbrüter mit beliebig großem Fassungsvermögen verwendet. Bei ständiger Luftumwälzung und Luftzufuhr zur ausreichenden Sauerstoffversorgung werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit entsprechend dem Bebrütungsstadium aufrechterhalten.
Zwischen Eioberfläche und Eiunterseite entsteht eine Temperaturdifferenz von ca. 2 °C. Bruteier müssen daher regelmäßig (beim Huhn mindestens 8 Mal täglich) gewendet werden, um eine gleichmäßige Ausbildung und Ausbreitung der Chorioallantoismembran unter der Eischale zu gewährleisten, über die der Gasaustausch während der Embryonalentwicklung stattfindet.
Als Schieren bezeichnet man das Durchleuchten der Eier mit einer Lichtquelle, um die Embryonalentwicklung und hygienischen Bedingungen im Brutapparat zu kontrollieren. Auf diese Weise können unbefruchtete oder abgestorbene befruchtete Eier aussortiert werden. Beim Huhn wird am 6. und 17. Tag der Schierprozess durchgeführt.
Wassergeflügeleier müssen in Intervallen gekühlt und mit Wasser besprüht werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
Ihrer Funktion nach werden Brutapparate in Vorbrüter (17 Tage beim Huhn) und Schlupfbrüter (4 Tage beim Huhn) unterteilt.
Vorbrut
Die Bedingungen für den ersten Brutabschnitt für Hühnerbruteier sind 37,5 bis 38 °C bei 50 bis 60% relativer Luftfeuchtigkeit und 5 bis 6 Kubikmeter Luftzufuhr pro 1.000 Bruteier pro Stunde. Die notwendige Luftfeuchtigkeit hängt von dem durch Eigröße und Schalendicke bestimmten Wasserverlust der Bruteier ab und kann durch Gewichtsbestimmung kontrolliert werden. Es werden nur Bruteier einer Gewichtsklasse gemeinsam gebrütet.
Schlupfbrut
Anlässlich des 2. Schierens erfolgt die Umlage der Bruteier in den Schlupfbrüter mit niedriger Temperatur von 37 °C, höherer relativer Luftfeuchtigkeit von 80 % und größerer Luftzufuhr von 12 Kubikmeter pro 1.000 Bruteier pro Stunde. Während des Schlupfes ist die Luftmenge pro Stunde auf 50 Kubikmeter zu steigern. Der Schlupf wird u.a. auch durch Stimmlautkontakt der Küken synchronisiert. Deshalb dürfen nur Bruteier gleicher Entwicklungsstufe gemeinsam in den Schlupfbrüter verbracht werden.
Bedingt durch den Nahrungsvorrat des Dottersacks sind die Küken in den ersten zwei bis drei Tagen nicht zwingend auf Nahrung angewiesen und können somit auch problemlos transportiert werden (zur Junghennenaufzucht oder Broilerhaltung. Da ihre Wärmeproduktion nach dem Schlupf nicht voll ausgebildet ist, sind Küken in den ersten Lebenstagen auf künstliche Wärmequellen angewiesen. Durch Sexing wird das Geschlecht bestimmt.
Bruthygiene
Bruteier sollen nur von gesunden, krankheitserregerfreien Elterntieren stammen, die vollwertig ernährt und tiergerecht gehalten werden. Ein richtiges Geschlechtsverhältnis oder angemessene Besamungsintervalle garantieren eine hohe Befruchtungsrate.
Bei Naturbrut erfolgt nach dem Anpicken der Eischale durch das Küken bereits ein Kontakt mit der mikrobiellen Normalflora. Dies ist wünschenswert und vorteilhaft für die Aufzucht. Der Kontakt mit pathogenen Erregern kann hingegen die Nachzucht gefährden (z.B. Virus der Marek’schen Krankheit). Daher ist zur Unterbrechung der Infektkette bei der Erzeugung großer Kükenzahlen die Kunstbrut unentbehrlich.
Bei Brutei-Infektionen wird unterschieden zwischen:
- primären transovariellen (vertikalen) Infektionen, die hämatogen im mütterlichen Organismus in den Eifollikel gelangen und
- sekundären Infektionen, die zwischen Ablage und Sammeln der Eier oder in der Brüterei erfolgen.
Wegen der Tragweite dieser möglichen Infektionswege müssen Brutanlagen höchsten hygienischen Anforderungen entsprechen.
Im EU-weiten Regelwert werden die Voraussetzungen für eine Zulassung und die Überwachung der Zuchtbetriebe, Vermehrungsbetriebe und Aufzuchtbetriebe sowie der Brütereien dezidiert geregelt.
Ziele der Regulierungen:
- Verminderung des Eintrags pathogener Keime in die Brüterei
- Vermeidung der Verschleppung von pathogenen Keimen und Zoonoseerregern
Entscheidende Maßnahmen:
- Bauliche Ausgestaltung sowie Einteilung der Räume in reine und unreine Seiten
- Luftführung über keimdichte Filter, Überdruck
- Brutanlage, Einrichtungen und Gerätschaften peinlichst sauber halten und ständig desinfizieren
- Bakteriologische Stufenkontrollen zur Absicherung
- Personalbereich nach unreiner und reiner Seite organisieren, getrennte Schutzkleidung und Desinfektionsmaßnahmen
- Fremdpersonen nur in begründeten Fällen und nur mit brütereieigener Schutzkleidung zugelassen
- Küken gegebenenfalls vor der Auslieferung aus der Brüterei durch Impfungen (z.B. Marek'sche Krankheit) schützen
Bruterfolg
Der Bruterfolg wird durch den Erbwert, die ausreichende Ausstattung des befruchteten Vogeleies mit Nährstoffen, Mineralstoffen, Schutzstoffen und Wirkstoffen und äußere Ereignisse beeinflusst. Gute Brut- und Schlupfergebnisse mit hoher Kükenqualität verlangen neben der Bruttauglichkeit der Eier (saubere, unverletzte Schale, Form, Größe) große Umsicht:
- Bei der Naturbrut seitens des Brutvogels (primär Elterntiere ausschlaggebende Faktoren).
- Bei Kunstbrut von allen Personen, die mit Sammeln, Transport, Lagerung, sowie der eigentlichen Brut befasst sind (Bruttechnologie und Bruthygiene).
Mangelhafter Bruterfolg
Unbefriedigende Schlupfergebnisse oder schlechte Kükenqualität werden häufig als "Brutfehler" bezeichnet. Diese sind auf fehlerhafte Bruteigewinnung, mangelnde Hygiene und nur zum Teil auf Fehler im Verlauf der Kunstbrut zurückzuführen.
| Befund | Ursache |
|---|---|
| Eier unbefruchtet |
|
| Embryonen abgestorben |
|
| Schlupf ungleichmäßig |
|
| Küken stecken geblieben |
|
| Küken feucht, schwammig, klebrig |
|
| Omphalitis |
|
| Missbildungen, Mehrlinge |
|
Weblinks
- Richtlinie 2009/158/EG des Rates über die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den innergemeinschaftlichen Handel mit Geflügel und Bruteiern und für ihre Einfuhr aus Drittländern, kodifizierte Fassung, abgerufen am 09.01.2020
Literatur
- Siegmann, Otfried. Neumann, Ulrich. Kompendium der Geflügelkrankheiten (7. Überarbeitete Auflage). Schlütersche Verlag.
- Hoy, Steffen. Nutztierethologie. UTB-Verlag.