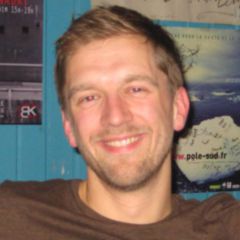Bacillus Calmette-Guérin
franz.: Bacille Galmette-Guérin
Abkürzung: BCG
Definition
Beim Bacillus Calmette-Guerin handelt es sich um einen attenuierten Stamm des humanpathogenen Tuberkuloseerregers Mycobacterium bovis. Besondere Bedeutung erlangte BCG durch seine Verwendung als Tuberkuloseimpfstoff.
Geschichte
Der BCG-Stammbaum lässt sich auf ein Mycobacterium bovis-Isolat zurückführen, das 1901 von Edmond Nocard gewonnen wurde. Es stammt von einer Kuh, die an tuberkulöser Mastitis erkrankte.
1908 begannen Camille Guérin und Albert Calmette am Institut Pasteur in Lille den Stamm in Nährmedien aus Kartoffeln, Glycerin und Galle zu kultivieren. Dabei zeichnete sich ab, dass der Stamm an Virulenz verlor. Die in Lille begonnene Arbeit wurde ab 1919 in Paris fortgesetzt. Nach 13 Jahren und insgesamt 230 Passagen wurde 1921 zum ersten Mal über eine erfolgreiche Verwendung als Tuberkuloseimpfstoff beim Menschen berichtet.
Anschließend, ab 1924, wurde der ursprüngliche Pariser BCG-Stamm an Labors in der ganzen Welt versandt und dort weiter kultiviert. So kam es, dass sich viele weitere BCG-Linien entwickelten, die sich sowohl genetisch, als auch in ihrer Immunogenität unterscheiden.
Verwendung
Tuberkuloseimpfstoff
Die BCG-Impfung wird als intrakutane Lebendimpfung durchgeführt. Sie schützt nicht vor einer Ansteckung oder Weiterverbreitung der Keime und beeinflusst den Krankheitsverlauf der Tuberkulose bei Erwachsenen nur geringfügig. Jedoch verhindert die Impfung insbesondere bei Kindern gefürchtete Komplikationen wie eine Miliartuberkulose oder eine tuberkulöse Meningitis relativ zuverlässig.
Seit 1998 wird die BCG-Impfung für Kinder in Deutschland nicht mehr von der ständigen Impfkommision empfohlen. Wegen rückläufiger Erkrankungszahlen würden die mit einer Lebendimpfung verbundenen Impfkomplikationen den Nutzen dieser Impfung überwiegen.
Immuntherapie bei Blasenkrebs
Bereits 1929 beoachtete Pearl, dass Tuberkulosepatienten seltener maligne Tumoren entwickelten als eine gesunde Kontrollgruppe. 1976 wurde von Morales erstmals BCG in einer kleinen klinischen Studie zur Bekämpfung von Blasenkrebs erfolgreich eingesetzt.
Heutzutage wird die intravesikale Instillation von BCG im Anschluss an die chirurgische Entfernung des Tumors (transurethrale Blasenresektion) angewandt, um die Rezidivwahrscheinlichkeit zu vermindern bzw. das Auftreten eines Rezidivs hinauszuzögern. Die genauen Mechanismen, die der Anti-Tumor-Wirkung von BCG zugrunde liegen, sind bisher noch unklar.
Bei einem Carcinoma in situ (CIS) der Harnblase wird primär eine BCG-Instillationstherapie vorgenommen. Diese kann nach 3-6 Monaten, sofern in einer Biopsie die Persistenz des Tumors nachgewiesen werden kann, wiederholt werden. Ist das CIS auch danach noch nachweisbar, wird eine radikale Zystektomie empfohlen.
siehe auch: BCG-Infektion