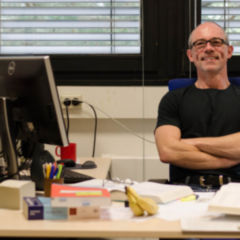Metformin
Definition
Metformin ist ein zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 eingesetztes orales Antidiabetikum. Chemisch gehört Metformin zur Klasse der Biguanid-Derivate und ist zur Zeit (2019) in Deutschland das einzige zugelassene Medikament seiner Art.
Wirkmechanismus
Metformin hemmt den mitochondrialen Komplex 1 (NADH-Ubichinon-Oxidoreduktase) der Atmungskette in der Leber und führt durch eine Verminderung der ATP-Synthese zu einer reduzierten Energiebereitstellung zugunsten einer Steigerung der anaeroben Glykolyse. Die hierdurch induzierte Konzentrationserhöhung von ADP und AMP in Hepatozyten verstärkt die Hemmung der Adenylylcyclase. Dies erfolgt durch Bindung von AMP an die »p-site« dieses Enzyms, was eine verringerte Bereitstellung von cAMP für die Glucagon-induzierte hepatische Glukoseproduktion zur Folge hat.[1] In der Folge steigt das Laktat an. Darüber hinaus wird die Glukoseabgabe der Leber und die Glukoseproduktion in der Leber vermindert.
Insgesamt wird durch diesen Prozess die Glukoseaufnahme peripherer Gewebe (z.B. der Skelettmuskulatur und der Fettzellen) gesteigert. Der Blutzucker sinkt dadurch unter der Therapie mit Metformin ab.
Darüber hinaus wird vermutet, dass die Wirkung von Metformin auf die Glukoneogenese zumindest teilweise auf der Hemmung des Transkriptionsfaktors KLF15 basiert.
Pharmakokinetik
Nach oraler Gabe wird Metformin zu etwa 60% resorbiert. Nach älterer Anschauung wird Metformin im menschlichen Organismus nicht metabolisiert.[2] Neuere Untersuchungen zeigen jedoch, dass Metformin zumindest teilweise durch CYP2C11 und CYP2D1 verstoffwechselt wird.[3] Die Elimination erfolgt jedoch größten Teils unverändert durch tubuläre Sekretion über die Nieren. Die Halbwertszeit von Metformin beträgt ca. 3 Stunden.
Indikationen
Metformin ist derzeit (2019) erste Wahl für die medikamentöse Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2, insbesondere bei übergewichtigen Patienten. Gelingt innerhalb von 3 Monaten durch Diät und Bewegung keine ausreichende Gewichtsreduktion und Einstellung des Stoffwechsels, sollte Metformin angeordnet werden. In mehreren großen klinischen Studien hat Metformin die besten Resultate bezüglich der Verhinderung diabetischer Komplikationen (z.B. diabetische Makroangiopathie, diabetische Retinopathie) erzielt.
Zusätzlich zur guten Wirksamkeit kommt es unter der Therapie mit Metformin nicht zu einer für den Patienten ungünstigen Gewichtszunahme, wie es beispielsweise bei Sulfonylharnstoffen und Glitazonen der Fall ist.
Off-Label wird Metformin zur Behandlung des PCOS eingesetzt.
Nebenwirkungen
Bei Einnahme von Metformin kann es bei Nichtbeachtung der Kontraindikationen durch den verordnenden Arzt zur Ausbildung einer Laktatazidose kommen. Die Laktatazidose wird wahrscheinlich durch eine Blockade der Gluconeogenese und die daraus resultierende Anhäufung von Pyruvat und Laktat ausgelöst. In hypoxischen Arealen mit eingeschränkter Perfusion (z.B. bei Patienten mit Herzinsuffizienz) kann es zu einer zusätzlichen Laktatakkumulation kommen. Daher sollte vor Gabe von Metformin eine Abklärung von Komorbiditäten erfolgen, die mit einer eingeschränkten Gewebeperfusion bzw. einer Hypoxie einhergehen (z.B. pAVK, COPD, Herzinsuffzienz).
Weitere, weniger gefährliche Nebenwirkungen betreffen den Gastrointestinaltrakt (Übelkeit, Diarrhö).
Kontraindikationen
Generell sind alle Zustände mit vermehrtem Auftreten eines anaeroben Stoffwechsels und der folgenden Bildung von Laktat eine absolute Kontraindikation für Metformin. Zu den Kontraindikationen zählen:
- Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff
- Diabetische Ketoazidose, diabetisches Koma
- Laktatazidose
- Niereninsuffizienz (GFR < 30 ml/min/1,73 m2)[4]
- Akutzustände, die zu einer Beeinträchtigung der Nierenfunktion führen können, z.B.
- Leberinsuffizienz
- Dekompensierte Herzinsuffizienz
- Frischer Myokardinfarkt
- Respiratorische Insuffizienz
- Alkoholismus, Alkoholintoxikation
- Fasten
Die Behandlung mit Metformin muss unterbrochen werden bei
- großen chirurgischen Eingriffen
- Untersuchungen mit iodhaltigen Kontrastmitteln i.v.
Podcast

Quellen
- ↑ Pharmazeutische Zeitung Metformin hemmt Glucagon-Signalling. Pharmazeutische Zeitung online 16/2013, abgerufen am 9.08.16
- ↑ Beckmann R: Absorption, distribution in the organism and elimination of metformin. Diabetologia October 1969, Volume 5, Issue 5, pp 318-324
- ↑ Choi YH, Lee MG: Effects of enzyme inducers and inhibitors on the pharmacokinetics of metformin in rats: involvement of CYP2C11, 2D1 and 3A1/2 for the metabolism of metformin Br J Pharmacol. Oct 2006; 149(4): 424–430. PMCID: PMC1978432
- ↑ DAZ online: Gelockerte Kontraindikationen: Metformin-Packungsbeilagen werden geändert 04.11.2016, abgerufen am 16.2.2018
Bildquelle
- Bildquelle Podcast: © Midjourney + ChatGPT + Photoshop Firefly