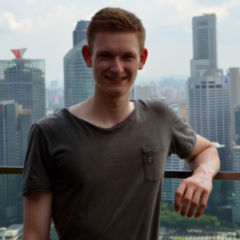Gedächtnis
Englisch: memory
Definition
Unter dem Gedächtnis versteht man die Fähigkeit des Gehirns, beliebige Informationen (z.B. gelerntes Wissen) zu speichern, zu assoziieren und sie später wieder abrufen zu können.
Den Vorgang der erneuten Präsenzwerdung von Gedächtnisinhalten im Bewusstsein bezeichnet man als Erinnerung.
Einteilung
Es gibt verschiedene Arten von Gedächtnis:
Kurzzeitgedächtnis
Das Kurzzeitgedächtnis wird auch als primäres Gedächtnis bezeichnet und dient der Aufnahme von 3 bis 4 Informationseinheiten, die nur einmal kurzzeitig dargeboten wurden.[1]Die Informationen werden für höchstens eine Minute gespeichert. Sein Sitz wird beim Menschen im Hippocampus vermutet.
Arbeitsgedächtnis
Das Arbeitsgedächtnis ist ein Teil des Kurzzeitgedächtnisses, das sowohl Informationen speichert als auch verarbeitet. Aufgenommene Informationen werden mit Inhalten aus dem Langzeitgedächtnis abgeglichen.[2][3]
Das Arbeitsgedächtnis wird beispielsweise zum Lesen und Schreiben benötigt.[4]
Altgedächtnis
Das auch als tertiäres Gedächtnis oder Langzeitgedächtnis bezeichnete Altgedächtnis enthält Informationen, die oft wiederholt wurden und einen hohen Emotionsgehalt besitzen und deshalb für lange Zeit behalten werden sollen. Die Informationen werden getrennt nach inhaltlichem, visuellem und auditivem Wissen kodiert und gespeichert. Die Dauer der Speicherung ist dabei sowohl von der Speicherkapazität als auch von der Art der Informationsorganisation abhängig. Sie kann durch Redundanz, d.h. Wiederholung, sowie durch Suggestion einer erhöhten Wichtigkeit (Platzierung am Anfang oder Ende eins Vortrags) erhöht werden.
Weitere Formen
Es ist möglich, unser Gedächtnis weiter zu unterteilen. Im impliziten Gedächtnis werden Fertigkeiten gespeichert, die von uns unbewusst ausgeübt werden können. Dazu gehören z.B. das Zuknöpfen einer Jacke oder auch das Betätigen eines Lichtschalters. Bewusst aus der Umwelt aufgenommene Daten dagegen, wie beispielsweise eine Vokabelbedeutung, werden vom expliziten Gedächtnis gespeichert, bei dem wahrscheinlich die Großhirnrinde und der Hippocampus zusammenarbeiten. Der Hippocampus hat wohl auch die Funktion eines Zwischenspeichers für die Übertragung expliziter Daten in das Langzeitgedächtnis.
Biomolekulare Vorgänge bei der Informationsspeicherung
Die Datenspeicherung im Kurzzeitgedächtnis erfolgt wahrscheinlich durch biochemische Reaktionen an Kanalproteinen der postsynaptischen Membranen. Sie werden durch die elektrotonischen Erregungszustände, die die Informationen darstellen, hervorgerufen. Die Bildung des Langzeitgedächtnisses basiert dagegen wahrscheinlich durch die Veränderung der Synapsen, wodurch die Erregungsübertragung verbessert wird. Dieses Phänomen wird als Langzeitpotenzierung bezeichnet. Dabei wird durch eine kurze Aktionspotentialserie ein entsprechend starkes EPSP ausgelöst, das in der postsynaptischen Membran die Blockierung eines sog. Torschalterproteins (ein Kanalprotein) durch Magnesiumionen aufhebt. Wenn sich an dieses Kanalprotein (Glutamatrezeptor) der Transmitter Glutamat (aus der präsynaptischen Membran) bindet, öffnet sich der Kanal, und Calciumionen strömen ein. Die Calciumionen aktivieren verschiedene Enzyme, von denen einige vermutlich die Kanaldichte erhöhen und die Membranproteine so verändern, dass die Synapse effizienter arbeitet.
Die Langzeitpotenzierung kann nur länger existieren, wenn ein Transmitter von der postsynaptischen auf die präsynaptische Membran rückwirkt. Dabei handelt es sich um das Gas Stickstoffmonoxid, das durch die Enzymaktivierung entsteht und die Anpassungsvorgänge auf beiden Seiten der Synapse koordiniert. Weitere Prozesse der Bildung des Langzeitgedächtnisses laufen unter der Beteiligung von Genen und Proteinen ab. So aktiviert ein Protein in den Zellkernen der sensorischen (afferenten) Neuronen Regulatorproteine für die Transkription der Daten, die ihrerseits die Synthese anderer Proteine hervorrufen, die für die Langzeitspeicherung zuständig sind. Schließlich konnte nachgewiesen werden, dass sich durch die Aktivierung der Gene die Zahl der Endknöpfchen der sensorischen Neuronen an den motorischen (efferenten) Neuronen erhöht.
Quellen
- ↑ Pschyrembel Online Kurzzeitgedächtnis, abgerufen am 28.09.2021
- ↑ Kiese-Himmel. Das Arbeitsgedächtnis – eine Bestandsaufnahme, Sprache-Stimme-Gehör, 2020
- ↑ Arbeitsgedächtnis – Dorsch - Lexikon der Psychologie, abgerufen am 28.09.2021
- ↑ Max-Planck-Gesellschaft Lesen formt das Gehirn, abgerufen am 28.09.2021
Literatur
- Bickel, Eckebrecht, Krull, Loth, Ponzelar-Warter: Natura Neurobiologie und Verhalten, Stuttgart 1997
- Werner Buselmaier (Hrsg.): Abiturwissen Biologie, Augsburg 1995
- Erwin-Josef Speckmann: Bau und Funktionen des menschlichen Körpers, München 1994
siehe auch: Gedächtnisstörungen