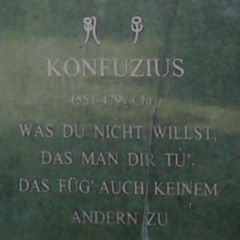Generalisierte Angststörung
Englisch: generalized anxiety disorder
1. Definition
Bei der generalisierten Angststörung handelt es sich um eine besondere Form der Angststörung, bei der eine Verselbständigung der Angst vorliegt.
- ICD-10: F41.1
2. Symptome
Betroffene Patienten leben in ständiger Sorge und ängstlicher Anspannung, bezogen auf alle Bereiche des alltäglichen Lebens, wobei sich der Gedankeninhalt um negative erwartete Folgen und Konsequenzen dreht. Die Betroffenen sind innerlich unruhig, schnell ermüdbar, aber auch reizbar und zeigen Konzentrationsschwierigkeiten. Sie haben in Angstsituationen einen erhöhten Muskeltonus durch die psychische Anspannung und leiden oftmals unter Schlafstörungen. Der Leidensdruck der Betroffenen ist in der Regel hoch. Aufgrund der anhaltenden Ängste entwickeln sie auf Dauer ein krankheitstypisches Vermeidungs- und Rückversicherungsverhalten. Zur Diagnosestellung laut ICD-10 müssen die erwähnten Symptome mindestens für den Zeitraum von 6 Monaten vorliegen.
2.1. Beispiele für Vermeidungsverhalten
- Häufige Telefonate mit Angehörigen
- Rechnungen oder Briefe nicht öffnen
- Autofahrten vermeiden
- Zeitweise kein Annehmen von Telefonaten
- Häufige Arztbesuche
- Übertrieben wirkendes Rückversichern innerhalb des sozialen Umfeldes
2.2. Häufige Angstinhalte
- Gesundheit
- Finanzen
- Arbeit
- Familie und soziales Umfeld
- Weltgeschehen
- Beziehungen
3. Epidemiologie
Der Erkrankungsgipfel liegt meist zwischen dem 20.-30. Lebensjahr. Frauen sind häufiger betroffen und erkranken im Durchschnitt früher als Männer. Die Lebenszeitprävalenz liegt zwischen 3 und 5 %, die Punktprävalenz bei 1 bis 3 %. Bei unverheirateten Personen treten Angststörungen häufiger auf.
4. Differentialdiagnosen
- Persönlichkeitsstörungen
- Depression mit wahnhafter Symptomatik
- andere Angststörungen (Panikstörungen oder spezifische Phobien)
- hypochondrische Störungen
5. Therapie
5.1. Nicht-medikamentöse Therapie
- Verhaltenstherapie
- Psychoanalyse
- Entspannende Therapieformen: Progressive Muskelentspannung, Yoga, Sport
- Stufenweise Konfrontationstherapie
- Kognitive Gesprächstherapieformen
5.2. Pharmakotherapie
Zur medikamentösen Therapie werden u.a. Benzodiazepine zur Kurzzeittherapie in akuten Phasen, nieder- und/oder hochpotente Neuroleptika, Stimmungsstabilisierer, Lithium und Antidepressiva eingesetzt. Ggf. können als Begleittherapie Phytopharmaka (Baldrian, Hopfen, Lavendeltee, Johanniskraut) gegeben werden.
5.2.1. Medikamente 1. Wahl für die Langzeittherapie
- Citalopram, 10-40 mg/Tag
- Duloxetin, 60-120 mg/Tag
- Escitalopram,10-20 mg/Tag
- Paroxetin, 20-60 mg/Tag
- Pregabalin, 150-600 mg/Tag
- Venlafaxin, 75-225 mg/Tag
5.2.2. Medikamente 2. Wahl für die Langzeittherapie
- Buspiron, 15-60 mg/Tag - in der Regel 30 mg/Tag
- Imipramin, 75-200 mg/Tag - in der Regel 100-150 mg/Tag
- Opipramol, 100-300 mg/Tag - in der Regel 200 mg/Tag
5.2.3. Medikamente für die Kurzzeit- bzw. Bedarfstherapie
- Alprazolam, 1,5-6 mg/Tag - in der Regel 3mg/Tag
- Baldrian, 350-1.350 mg/Tag
- Diazepam, 2-10 mg/Tag
- Hydroxyzin, 37,5-75 mg/Tag
- Lorazepam, 0,5-7,5 mg/Tag
- Melperon, 25-75 mg/Tag
- Promethazin, 10-100 mg/Tag
6. Verlauf
Die Erkrankung kann episodenweise mal stärker und dann wieder schwächer auftreten, sodass das klinische Bild Schwankungen in der Intensität aufweist.