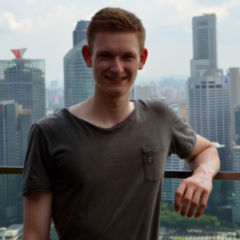Epicondylitis humeri lateralis
Synonyme: Epicondylitis humeri radialis, "Tennisellenbogen", "Tennisarm"
Englisch: lateral epicondylitis
Definition
Die Epicondylitis lateralis humeri bezeichnet eine Insertionstendopathie der am Epicondylus lateralis humeri entspringenden Unterarmextensoren. Meist ist dabei die Insertionsstelle der Sehne des Musculus extensor carpi radialis brevis betroffen.
Epidemiologie
Betroffen sind zumeist Männer und Frauen mittleren Alters (35-50 Jahre).
Ätiolopathogenese
Die Epicondylitis lateralis humeri gehört zu den Cumulative Trauma Disorders (CTDs). Ursächlich ist die relative Überlastung der speichenseitigen Handstrecker. Die reaktive Verspannung führt zu einer mechanischen Überbeanspruchung mit Mikroläsionen am Ansatz dieser Muskeln am Epicondylus lateralis. Auch traumatische Ereignisse (Kontusionen) am Epicondylus direkt können diese Folge haben.
Am Anfang steht die schmerzhafte Verspannung der genannten Extensoren, da die Streckung der Mittelhand gegenüber dem Unterarm eine Hilfsbewegung beim kräftigen Faustschluss darstellt. Die Ansatzmyopathie am Epicondylus ist erst die Spätfolge. Durch die hohe Beanspruchung der Extensorenmuskulatur bei ungünstiger Griffhaltung und Schlagtechnik im Tennissport hat sich die synonyme Bezeichnung des Tennisellenbogens etabliert.
Klinik
Die Epicondylitis lateralis humeri äußert sich vornehmlich durch Schmerzen des lateralen Ellbogens bei Streckung der Mittelhand gegenüber dem Unterarm im Handgelenk. Zudem besteht eine Druckdolenz der Muskulatur und in der Folge auch des Epicondylus lateralis bei ggf. geringgradiger Schwellung des betroffenen Areals.
Sensibiliätsstörungen kommen nur vor, wenn der Musculus supinator ebenfalls verspannt ist und so den Nervus radialis einengt. Dies ist allerdings als eigenständige Diagnose zu betrachten (Supinatortunnelsyndrom).
Diagnostik
Funktionsprüfung
Charakteristische Schmerzen sind durch verschiedene Bewegungen provozierbar. Diese umfassen
- die Drehung des Unterarmes
- die Streckung des Mittelfingers gegen einen vom Untersucher ausgeübten Widerstand
- Thomson-Test: Streckung des Handgelenkes ohne und gegen einen vom Untersucher ausgeübten Widerstand
- Cozen-Test: Streckung des Handgelenks mit geballter Faust gegen einen vom Untersucher ausgeübten Widerstand, während der laterale Epicondylus vom Untersucher palpiert wird
Apparative Diagnostik
Zur Bildgebung werden verschiedene Verfahren zum differentialdiagnostischen Ausschluss anderer Erkrankungen (s.u.) herangezogen.
- Sonographie: Im sonographischen Befund zeigt sich eine echoarme Formation über der betroffenen Ansatzstelle. Bei wiederkehrenden Schmerzen oder auch nach Kortisoninjektionen sind kleine Verkalkungen zu sehen.
- Röntgen ist bei dieser Erkrankung nicht angezeigt und nicht hinweisgebend.
- MRT: MRT-diagnostisch findet sich eine Signalanhebung im Bereich der Läsion
Differentialdiagnostik
Differentialdiagnostisch sollten mittels körperlicher Untersuchung und Bildgebung verschiedene Erkrankungen ähnlicher Symptomatik ausgeschlossen werden:
Therapie
Konservative Therapie
Initial sollten die entzündlichen Prozesse durch Schonung, kalte Umschläge, Kryotherapie und Salbenverbände eventuell auch durch Einnahme von retardierten NSAR beendet werden. Gleichzeitig sollte die Ursache abgestellt werden. Kräftiger Faustschluss sowie das kontinuierliche Strecken der Mittelhand und des Zeige- sowie des Mittelfingers bei der Arbeit mit einer Maus am Computer sollten vermieden werden. Zusätzlich ist das konsequente exzentrische Training der Extensoren durchzuführen.
Manuelle Therapie zur Detonisierung der Extensoren und umgebenden Faszien kann ebenfalls angezeigt sein. Akupunktur wird manchmal als ergänzende Therapie eingesetzt, hat aber keine klare Wirkrationale. Von lokalen Injektionen mit Glukokortikoiden ist eher abzuraten, da sie zwar vorübergehend schmerzlindernd wirken, die Patienten hiervon langfristig aber nicht profitieren.
Physiotherapie
Zum Erlernen physiologischer Bewegungsabläufe und Korrektur von Fehlstellungen erweist sich insbesondere bei chronischen Krankheitsverläufen und Rezidiven eine physiotherapeutische Anleitung als sinnvoll. Die manuelle Therapie im Rahmen der Physiotherapie umfasst u.a.:
- Querfriktionen
- Funktionsmassage
- Ultraschalltherapie (auch Phonophoresen u.a. mit Diclofenac)
- Iontophorese
- Flächige Aufdehnung der Unterarm-Extensoren
- Dynamisches Training der Unteram-Extensoren mit Betonung der exzentrischen Bewegung
Operative Therapie
Bei Sehnenrupturen, therapierefraktärem oder chronischem Verlauf besteht die Indikation einer operativen Intervention, wobei in der Regel durch Inzision der Sehne (Tendotomie) eine dauerhafte schmerzlindernde Entlastung des Muskels erreicht werden kann.
Mögliche operative Verfahren sind:
- Operation nach Hohmann: Querinzision der Sehne
- Operation nach Goldie: Längsinzision der Sehne
- Operation nach Wilhelm: Denervation des betroffenen Areals, meist in Kombination mit einem der oben genannten Verfahren
Strahlentherapie
Bei Nichtansprechen anderer konservativer Therapieoptionen kann eine Röntgenreizbestrahlung (3-6 Gy) in Betracht gezogen werden.